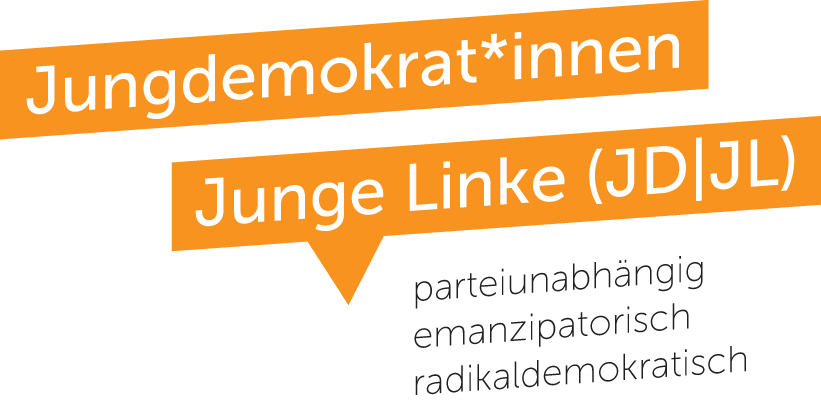Archiv
Antifaschismus
Am 2. Februar jährt sich der Sieg der Roten Armee über die deutsche 6. Armee im Kessel von Stalingrad zum 60. Mal. Dieser Sieg leitete die Wende im II. Weltkrieg ein. Anlässlich des Jubiläums bereiteten ARD und ZDF aufwändige Mehrteiler vor, Spiegel und Stern machten mit dem Thema auf, der Deutschlandfunk liest seit Monaten aus Feldpostbriefen von Stalingrad-Landsern vor.
Ein Mythos entsteht …
In Deutschland ist „Stalingrad“ schon lange zum Mythos geworden, bereits in den fünfziger Jahren gab es unzählige Veröffentlichungen. Das Thema bot sich dafür auch an. Eine ganze Armee hat die Wehrmacht verloren, über Monate mussten Hunderttausende Soldaten im Kessel zubringen, der erhoffte „Entsatz“ von außen kam nicht. Die fanatisierten deutschen Soldaten kämpften, obwohl halb verhungert, bis zum Tod, am Ende konnte die Rote Armee gerade mal 110.000 von ehemals 250.000 Wehrmachtssoldaten gefangen nehmen. Dazu kommt das naturkatastrophen-, schicksalhafte der Schlacht. Eingeschlossen von übermächtigen Gegnern, in einer eisigen Steppenlandschaft, kaum Verpflegung. Identifikationsverstärkend tritt hinzu, dass es sich bei den Akteuren um vermeintlich „normale“, meist sehr junge Männer handelte und nicht um Angehörige der SS. Und am Ende kehren aus der Kriegsgefangenschaft gerade einmal 5.000 zurück.
Das neuerliche Interesse an den deutschen Leiden im Krieg, vor allem auch die Veröffentlichungen zur Bombardierung deutscher Großstädte, hat eine Tendenz zum Geschichtsrevisionismus. Den Zweiten Weltkrieg als das individuelle Leid deutscher Soldaten und Zivilisten darzustellen, bedeutet, den historisch-politischen Zusammenhang auszublenden. Die Frage nach der deutschen Schuld und Verantwortung wird so auf Einzelpersonen (Hitler, die Naziführung) abgeschoben. Wo nur die Feldpostbriefe der deutschen Landser vorkommen, werden die sowjetischen Opfer gerade im Kontrast abstrakt. Der Hörer nimmt automatisch die Perspektive des deutschen Soldaten ein. Von da ist es nicht mehr weit dazu, unter dem Slogan des Gedenkens an die „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ alle „Leiden“ auf eine Stufe zu stellen.
Es war ein Vernichtungskrieg, den die Wehrmacht führte
Niemand spricht von der Bombardierung Stalingrads, die dem Kessel vorausging. Die erste Volkszählung nach der Schlacht ergibt noch 10.000 überlebende Einwohner von vormals einer Million. Ebenso wenig wird meist über die Verbrechen der angeblich so anständigen deutschen Landser beim Vormarsch auf die Wolga gesprochen. Die Wehrmachtsaustellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung hat detailliert nachgewiesen, wie sehr eben auch die Wehrmacht an Kriegsverbrechen beteiligt war und welch zentrale Rolle sie bei der Durchführung der Judenvernichtung einnahm.
Dass am Ende nur 5.000 deutsche Soldaten die Kriegsgefangenschaft überlebten, ist nicht etwa der schlechten Behandlung durch die Rote Armee zuzuschreiben, sondern vor allem der Tatsache, dass die Soldaten getreu dem Befehl des „Führers“ sich auch dann nicht ergaben, als sie monatelang ohne auch nur annähernd ausreichende Versorgung im Kessel ausharrten. Allein angesichts dieser selbstverschuldeten Ausgangsbedingungen hatten die ausgehungerten Soldaten keine Chance, die Kriegsgefangenschaft zu überleben. Auf Grund des deutschen Eroberungskriegs war es oft kaum möglich, die sowjetische Zivilbevölkerung ausreichend zu ernähren.
Die wichtigste Frage jedoch, über die viel zu wenig gesprochen wird, ist die Frage, was die Landser mitten in der Sowjetunion eigentlich zu suchen hatten. Die Begeisterung, mit der tausende „normale“ Deutsche in den Krieg gegen die „Bolschewisten“ zogen, mit der sie Führerbefehle wie den, „die gesamte männliche Bevölkerung zu beseitigen“ umsetzten, kommt nicht zur Sprache. Es wird nicht gesagt, dass der Krieg Vorstufe war für die Umsetzung des „Generalplans Ost“, der ganz Osteuropa mit „arischen“ Bauern kolonisieren wollte, wofür es Voraussetzung war, die gesamte „fremdrassische“ Bevölkerung zu versklaven oder zu ermorden. Man spricht auch nicht davon, dass jeder Tag, den die Wehrmacht „standhielt“, ein Tag war, an dem der Holocaust weitergehen konnte.
Stattdessen erzählt man sich lieber rührselige Geschichten und bemitleidet die deutschem Mörder, weil sie in der vereisten Steppe ihre Toten nicht beerdigen konnten.
Dem setzen wir eine andere Perspektive entgegen, getreu dem Schwur der Häftlinge von Buchenwald nach der Befreiung: Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg!
Antimilitarismus und Friedenspolitik
Grundsätzliches zu Antimilitarismus
Beschluss der 2. außerordentlichen Landeskonferenz der JungdemokratINNen / Junge Linke Berlin vom 10.11.2002
- JungdemokratINNen/Junge Linke lehnen den Einsatz militärischer Gewalt durch einzelne Staaten oder Bündnisse (bspw. NATO, WEU), welche nicht durch die Selbstverteidigung des eigenen Territoriums vor militärischen Übergriffen erforderlich ist, ab. Präventive bzw. präemptive Kriege werden von JungdemokratINNen/Junge Linke dementsprechend ebenso abgelehnt.
- JungdemokratINNen/Junge Linke lehnen militärische Sanktionsmaßnahmen der UNO nach der Charta der UN ebenfalls ab.
- JungdemokratINNen/Junge Linke halten statt dessen neben der Umsetzung der möglichen zivilen Konfliktlösungsmechanismen die Beseitigung der ungleichen sozio-ökonomischen Bedingungen für entscheidend zur Beendigung und Verhinderung von Kriegen und quasistaatlicher militärischer Gewalt.
- JungdemokratINNen/Junge Linke fordern die Abschaffung der Bundeswehr sowie die Auflösung von NATO und WEU.
- JungdemokratINNen/Junge Linke setzen sich kritisch mit antisemitischen Legitimationsmustern pseudofriedenspolitischer Positionen eines Teils der dt. Friedensbewegung auseinander.
- JungdemokratINNen/Junge Linke verstehen sich als Teil der Friedensbewegung. JungdemokratINNen/Junge Linke greifen die militärgestützte Außenpolitik der BRD und ihre geschichtsrevisionistische Herleitung an. JungdemokratINNen/Junge Linke lehnen einerseits eine Beteiligung der Bundesrepublik an Kriegen der USA oder anderer Militärbündnissen prinzipiell ab. Andererseits kritisieren wir die Konstitution einer militärischen Souveränität Deutschlands und der EU gegen die USA, auch wenn sie sich friedenspolitisch gibt.
Bundeswehr in Tradition und Krieg
Deutschland wieder gutgelobt – Die Bundeswehr zwischen Tradition und Kriegseinsätzen.
Der 20. Juli 1999 und das Oberkommando der Wehrmacht
Am 20. Juli werden die Stützen der Gesellschaft (selbst Bundeskanzler Schröder und Kriegsminister Scharping haben sich angesagt) die Bundeswehr und ihre angebliche demokratische Tradition abfeiern. Datum und Ort sind mit Bedacht gewählt. Im Bendlerblock, dem früheren Sitz des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) erhoben sich 1944 deutsche Militärs zum ersten und einzigen Mal gegen ihren obersten Kriegsherrn. Die nationalkonservativen Eliten der Wehrmacht – zuvor willige Vollstrecker deutscher Großmachtpolitik – planten zu einem Zeitpunkt den Umsturz, als der Krieg bereits verloren war.
Schon seit einigen Jahren versucht die Bundeswehr das Etikett des antifaschistischen Widerstandes zu vereinnahmen. Nicht zuletzt die rot-grünen Außen- und Militärpolitiker haben das Image der Bundeswehr kräftig modernisiert. Mit dem Kosovo-Krieg ist die Bundeswehr in eine neue Etappe der Legitimierung der eigenen Existenz eingetreten. Während noch Ende der 80er Jahre internationale Zurückhaltung aufgrund der nationalsozialistischen Vergangenheit selbst von der CDU eingefordert wurde, hat sich das Bild im vereinigten Deutschland komplett umgekehrt. Rot-Grün gelang, was für traditionsbewußte Konservative unmöglich war: Eine Imagekorrektur, die selbst die Werbefachleute für Persil oder Ariel vor Neid erblassen lassen würde. Die Lehre aus 12 Jahren Nationalsozialismus und zwei Weltkriegen lautet nicht mehr internationale „Selbstbeschränkung“, sondern künftig soll am deutschen Wesen wieder die Welt genesen. Ein rechter Traditionsverein für Demokratie und Menschenrechte oder gar der „bewaffnete Arm von amnesty international? „Krieg ist Frieden!“ Georg Orwell
Der 20. Juli und der staatliche Antifaschismus
Schon unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtergreifung regte sich aus unterschiedlichen politischen Richtungen Widerstand gegen das neue System: Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale, Anarchisten, Juden, Christen, Pazifisten und linke Intellektuelle zählten dazu. Sie alle fielen dem Nationalsozialismus zum Opfer. Sie wurden erschlagen, gefoltert, in Konzentrationslagern zu Tode gequält oder vergast. Jedoch nur an einem Tag gedenken die bundesdeutschen Eliten des antifaschistischen Widerstands: am 20. Juli. Das Datum wurde mit Bedacht gewählt. Nicht, weil es keine anderen Daten für das zentrale Gedenken gibt, sondern weil der militärische Widerstand um Stauffenberg, Goerdeler und Leuschner die besten Anknüpfungspunkte für die bundesrepublikanische Gesellschaft bot. Die antikommunistischen Ideen bzw. die autoritären und teilweise antisemitischen Vorstellungen der Verschwörer erschienen zeitgemäßer als die emanzipatorischen und antikapitalistischen Zukunftsentwürfe der diversen anderen Widerstandszirkel.
Am 20. Juli 1944 hatten einige Offiziere der Wehrmacht gemeinsam mit anderen Eliten versucht, Hitler zu ermorden und eine neue Regierung im Deutschen Reich zu errichten. Die Attentäter gehörten zu jenen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Eliten, die über zehn Jahre vom Nationalsozialismus profitiert und die sich noch zuvor maßgeblich an seiner Errichtung beteiligt hatten. Während der Machtübernahme sicherte Hitler den Wehrmachtseliten noch militärische Autonomie zu. Auch in Fragen der Rüstungspolitik, der Einführung der Wehrpflicht, der deutschen Großmachtpolitik und in der Sorge um „volkstumspolitische“ Gefahren bestand durchaus eine Nähe zum Regime. Deshalb sprach man auch hier von einer „Judenfrage“. Zu Beginn des Nationalsozialismus war bspw. Carl Friedrich Goerdeler, einer der Köpfe der Verschwörung vom 20. Juli, noch Hitlers Reichskommissar für die Preisbildung und saß im Kabinett. Johannes Popitz amtierte als Hermann Görings Finanzminister in Preußen und Hjalmar Schacht, der schon bei der rechtsextremen „Harzburger Front“ aktiv war, diente von 1934 – 37 dem „Führer“ als Reichswirtschaftsminister und bis 1939 als Reichsbankpräsident.
Aber auch noch zehn Jahre später bei den letzten Putschvorbereitungen zeigten sich einige der Hauptverschwörer keineswegs als bekehrte Antifaschisten, vielmehr als unbelehrbare Reaktionäre. So widersetzten sich Goerdeler und Hassler fast bis zuletzt einer Beteiligung des Gewerkschafters Wilhelm Leuschner und des Sozialdemokraten Julius Leber an der nach dem geplanten Sturz Hitlers zu bildenden Regierung. Und zu einer Zeit, da die Opfer des Terrors der SS und Gestapo schon Millionen zählten, spielte Popitz noch ernsthaft mit dem Gedanken, ausgerechnet deren Chef, den Reichsführer SS Heinrich Himmler, zum Nachfolger Hitlers zu machen. Die meisten anderen Verschwörer faßten entweder eine Militärdiktatur oder die Wiedererrichtung der Hohenzollern-Monarchie ins Auge.
Auch wenn es ohne Zweifel positiv zu bewerten ist, daß – einmalig in der deutschen Geschichte – hohe Militärs gegen ihren Obersten Kriegsherrn putschten, so sind doch auch ihre Begründungen für ihr Tun nicht unerheblich. Der Entwurf einer Regierungserklärung, die nach dem geglückten Umsturz veröffentlicht werden sollte, gibt Aufschluß. Dort heißt es: „…Aber noch ist Krieg. In ihm gebührt unser aller Arbeit, Opfer und Liebe den Männern, die das Vaterland verteidigen. …und daß wir diesen Krieg fernerhin mit reinen Händen, in Anstand, mit der Ehrenhaftigkeit, die jeden braven Soldaten auszeichnet, führen werden.“ Noch nicht einmal die Beendigung des Weltkrieges, den Deutschland vom Zaun gebrochen hatte, war das Ziel dieser sogenannten Widerständler. In ihrer Regierungserklärung wird er dreist zum Verteidigungskrieg umgelogen. Zwar kritisierten sie, daß der Krieg nur der „Eroberungssucht und dem Prestigebedürfnis eines Wahnsinnigen“ gedient hätte, aber die einzig richtige Konsequenz daraus zu ziehen – die sofortige Beendigung des Krieges zu fordern – waren sie nicht in der Lage, weil sie die Großmachtpläne Hitlers nicht nur teilten, sondern sogar an der konkreten Ausarbeitung und Umsetzung dieser Pläne beteiligt waren.
Aber auch auf innenpolitischem Gebiet waren die Differenzen zur nationalsozialistischen Führung nicht so groß, wie man bei der Formulierung „militärischer Widerstand“ annehmen könnte. Berthold Graf Stauffenberg, der Bruder des Attentäters, der mit zu den Verschwörern gehörte, sagte z. B.: „Auf innenpolitischem Gebiet hatten wir die Grundideen des Nationalsozialismus zum größten Teil durchaus bejaht: Der Gedanke des Führertums, …verbunden mit dem einer gesunden Rangordnung und dem der Volksgemeinschaft, … der Rassegedanke und der Wille zu einer neuen, deutsch bestimmten Rechtsordnung erschien uns gesund und zukunftsträchtig…“ Zwar hielten sie die Ausrottung des Judentums für falsch, waren aber dennoch antisemitisch genug, um Pläne für eine Aussiedlung der Juden und Jüdinnen nach Kanada oder Südamerika zu schmieden.
Es war bestimmt kein Zufall, daß die Verschwörer des 20. Juli erst 1944 ihre Abneigung gegen Hitler entdeckten und nicht schon beim Aufkommen der NSDAP oder wenigstens 1933, als viele andere für ihre Überzeugungen bereits mit Lagerhaft bezahlten. Sie waren zum Großteil überzeugte Nationalsozialisten und die Differenzen tauchten erst dann auf, als die nationalsozialistische Politik nicht mehr so erfolgreich war wie am Anfang. Und das ist es, was die Offiziere des 20. Juli in den Augen der bundesdeutschen Eliten vor den meisten anderen WiderstandskämpferInnen auszeichnet: Daß sie erst dann gegen die Führung aufbegehrten, als das Wohl des deutschen Staates in Gefahr war, erst dann und nur deswegen.
Das Vergessen der Beteiligung des 20. Juli am Vernichtungskrieg in der Sowjetunion und ihres Antisemitismus war Teil der deutschen „Wiedergutmachung“. Die Mär vom „anderen Deutschland“ gehörte zu den Lebenslügen einer ganzen Generation.
Traditionsverständnis bei der Bundeswehr
Nach dem Wechsel auf der Hardthöhe fährt der Verteidigungsminister Scharping einen Zickzackkurs. Das Gelöbnis soll wieder ins öffentliche Rampenlicht – aber verknüpft mit „antifaschistischen Daten“ wie dem 20. Juli. Kasernennamen sollen revidiert werden, allerdings nur in Abstimmung mit den Kommunen vor Ort. Zur „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger“ hat der Minister den Kontakt abgebrochen – zu offensichtlich waren ihre Verbindungen zu rechtsextremistischen Vereinen. Gleichzeitig wird jedoch öffentlich über die Einführung einer neuen Tapferkeitsauszeichnung nachgedacht. „Man muß über die Schaffung einer deutschen Tapferkeitsauszeichnung nachdenken. (…) Das Eiserne Kreuz als Tapferkeitsauszeichnung hat eine gute Tradition in Deutschland seit den Befreiungskriegen.“ (Nato-General und Bundeswehrinspekteur a.D. Naumann, 1999)
Und obwohl sich Scharping bemüht, den 20. Juli als zentrales Datum der Traditionsstiftung einzusetzen, werden kritischen Militärhistorikern, wie Detlef Bald, Lehraufträge an der Bundeswehrhochschule entzogen. Und natürlich distanziert sich auch die neue Bundeswehrführung von der Hamburger „Wehrmachtsausstellung“, die die Verbrechen der Wehrmacht aufgearbeitet hat.
Die idealisierte Erinnerung an das Stauffenberg-Attentat war im Land der Mitläufer und Mittäter zunächst allerdings unpopulär. Sie konnte ihre Wirkung als Symbolfigur des „anderen Deutschlands“ und einer „demokratischen Armee“ erst entfalten, nachdem jene integriert und amnestiert waren.
Es war ein langer Weg von der Diffamierung als „Vaterlandsverräter“ in den ersten zwei Jahrzehnten der Nachkriegszeit bis zur schrittweisen – wenn auch nicht unumstrittenen – offiziellen Anerkennung als „Aufstand des Gewissens“. Noch Mitte der 60er Jahre sahen 25 Prozent der Bundesbürger im Widerstand einen Fall von „Verrat“. So wurde noch in den ersten Nachkriegsjahren von den politischen Eliten der Bundesrepublik die politische und rechtliche Legitimation des Attentats diskutiert. Im öffentlichen Gedenken an den 20. Juli stellte sich das Widerstandsproblem anders dar – regelmäßig werden die offiziellen Gedenkfeiern zur Abrechnung mit anderen Formen des Widerstands genutzt. An einer ausdrücklichen Würdigung kommunistischen Widerstandes bestand auch hier kein großes Interesse, zumal die KPD in der Bundesrepublik zeitgleich mit der Wiederbewaffnung verboten wurde. Den politischen Akteuren war jedoch daran gelegen, diese polarisierenden Effekte zu überspielen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurde die breite – angeblich alle politischen Richtungen und sozialen Gruppen einbindende – Unterstützung des Widerstands vom 20. Juli betont. Nur so konnte aus dem Widerstand einiger Militärs ein „Symbol der Selbstachtung unseres Volkes und (…) einer Rehabilitierung in der Völkerfamilie“ werden (Heinrich Lübke, NSDAP-Mitglied und Bundespräsident).
Wie wohl keine andere staatliche Einrichtung war und ist die Bundeswehr mit diesem Datum konfrontiert. Zum einen geht es auch hier um das Verhältnis zwischen Wehrmacht / Nationalsozialismus und Bundeswehr, also um das schwierige Problem der soldatischen Traditionspflege. Zumal der weit überwiegende Teil derer, die seit Ende der 50er Jahre in die Kasernen einrückten, in der Wehrmacht treu gedient hatte. Andererseits – so hieß es in der für den Aufbau der Bundeswehr grundlegenden Himmeroder Denkschrift – müsse diese Anerkennung „mit der Achtung vor den vielen anderen Soldaten“ einhergehen, „die im Gefühl der Pflicht ihr Leben bis zu Ende eingesetzt haben“. Die Denkschrift wurde von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren verfaßt, die sich über einen zukünftigen deutschen „Wehrbeitrag“ Gedanken machten. In der öffentlichen soldatischen Traditionspflege zeigt sich insofern ein widersprüchliches Bild: Bundeswehrangehörige beteiligen sich ebenso selbstverständlich an der Gedenkfeier im Bendlerblock wie an Ehrenzeremonien vor Kriegerdenkmälern aus der NS-Zeit.
Militärische Traditionspflege kennt weder Demokratien noch Diktaturen, sondern nur den Staat. Und dies hat auch einen einfachen Grund. Die Aufgaben und die interne Organisation der Armeen sind in jedem Gesellschaftssystem identisch. Allein, um eine höhere Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung herzustellen, müssen unterschiedliche Legitimationen konstruiert bzw. andere Formen der unterschiedlichen Präsentation gefunden werden.
Die Gründung der Bundeswehr
Während nach dem Zweiten Weltkrieg die Städte noch von Trümmern und Kriegsinvaliden geprägt waren und die Bevölkerung mehrheitlich die Forderung „Nie wieder Krieg!“ unterstützte, begannen deutsche Politiker schon wieder, die Möglichkeit einer Remilitarisierung der Bundesrepublik ins Auge zu fassen. Ebenso, wie in der Wirtschaft, dem Staatsapparat und der Justiz die alten Kräfte wieder tätig wurden, konnte auch die neue Armee nur mit ehemaligen Nazis aufgebaut werden, die in der Wehrmacht dem „3. Reich“ bis zuletzt treu gedient hatten. Schon die ersten Berater der Bundesregierung in militärischen Fragen waren zuvor hohe Offiziere der Wehrmacht gewesen.
Bei allen Überlegungen hinsichtlich einer künftigen deutschen Streitmacht, die ehemalige Offiziere seit etwa 1948 in privaten Zirkeln anzustellen begannen und seit Sommer 1950 dann auch in offiziösen Denkschriften formulierten, spielte der Gesichtspunkt der Wiederherstellung der „soldatischen Ehre“ eine zentrale Rolle. Nicht die eigene Kriegsführung, sondern die Behandlung durch die Alliierten nach dem Ende des Krieges stand im Mittelpunkt der Debatte. Ohne eine prinzipielle Änderung dieser insgesamt als „Diffamierung“ empfundenen Situation wollte man sich für den Aufbau neuer, wie auch immer in den westlichen Verteidigungszusammenhang eingebundener deutscher Streitkräfte nicht zur Verfügung stellen. Und in der Himmeroder Denkschrift wurde die „Rehabilitierung des deutschen Soldaten durch eine Erklärung von Regierungsvertretern der Westmächte“ und eine entsprechende „Ehrenerklärung“ von Bundestag und Bundesregierung verlangt. Darüber hinaus wurde die Freilassung aller als Kriegsverbrecher verurteilten Deutschen gefordert.
Und so wurde – noch bevor der erste Soldat der Bundeswehr seinen Dienst antrat – die Ehre der Soldaten der Wehrmacht wiederhergestellt, die Kriegsverbrecher amnestiert und die größtenteils rechtsextremistischen Traditionsverbände wieder zugelassen. So war es wohl kaum ein Zufall, daß Kasernen und Kriegsschiffe nach alten Wehrmachtsoffizieren benannt wurden, alte faschistische Lieder in den Gesangsbüchern der Bundeswehr auftauchten oder ein Portrait von Hermann Göring im Offizierskasino eines Luftwaffengeschwaders aufgehängt wurde.
Aber zu den unverdauten Daten zählte für viele Bundeswehrangehörige und soldatische Traditionsverbände nicht zuletzt der 20. Juli 1944, dessen Niederschlagung noch von vielen ehemaligen Wehrmachtsoffizieren verteidigt wurde. Und so ist es kaum verwunderlich, daß der ehemalige Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr Günther Roth noch 1997 in der Auseinandersetzung um die „Wehrmachtsausstellung“ betonte: „Als militärisches Instrument war sie (die Wehrmacht; d. Red.) durch den Primat der Politik gezwungen, der Staatsführung zu gehorchen, als diese militärische Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen Absichten als unabdingbar notwendig erklärte.“ Also auch hier das Ideal des „unpolitischen Soldaten“.
Geschichte und Ideologie
Jeder Staat gibt sich eine offizielle Geschichtsschreibung, also jene Lesart der Geschichte, die in Schulbüchern, Gedenktagen oder Denkmälern zur Geltung kommt. Die offizielle Geschichtsschreibung vermittelt uns nicht nur, wie es – angeblich – gewesen ist, sondern wir erfahren zugleich, wie die vergangenen Formen von Staat und Gesellschaft aufzufassen und welche Konsequenzen daraus für die Bürger abzuleiten sind. Die offizielle Geschichtsschreibung soll also ein Orientierungsschema vermitteln, das die politischen Denk- und Verhaltensformen beeinflussen soll. Ein Geschichtsbild – und seine Interpretation – ist also in hohem Maße politisch bedeutsam. Gerade weil mit dem „richtigen“ Geschichtsbild Institutionen sich selbst legitimieren können, wird Geschichte immer auch ein Feld der politischen Auseinandersetzung bleiben. Und so ist es auch kaum verwunderlich, daß sich die Bundeswehr trotz belegter Wehrmachtsverbrechen von der „Wehrmachtsausstellung“ distanziert oder die kritische Betrachtung der beteiligten Personen des 20. Juli noch immer als linke Propaganda abgetan wird.
Germanische Rituale mit braunen Flecken
Gelöbnisse sind Ausdruck einer Tradition, die vordemokratischen Zeiten entstammt. Sie symbolisieren den militärischen Drill, die Entmündigung sowie die Ein- und Unterordnung des Einzelnen unter das Prinzip von Befehl und Gehorsam. Die Rekruten sind in dieser undemokratischen Zeremonie sichtbar ihrer Persönlichkeit beraubt. Das gleichgeschaltete Marschieren und Stillstehen der Rekruten, das monotone Nachsprechen der Gelöbnisformel, die exakte Befolgung der Befehle stehen für Unmündigkeit und Gleichschaltung. Eine Zeremonie, die den Grundwerten einer demokratischen und zivilen Gesellschaft entgegensteht.
Staatliche Institutionen – insbesondere Armeen – bedienen sich zur Legitimation der Selbstdarstellung schon immer eines historischen Hintergrundes. Dies gestaltet sich jedoch gerade bei einer deutschen Armee äußerst problematisch, gibt es doch keine demokratischen Vorbilder, an denen man sich orientieren könnte. Da jedoch soldatische Disziplin gegenüber demokratischen Idealen Vorrang hat, hält die Bundeswehr an dem obrigkeitsstaatlichen Relikt der Gelöbnisse und Vereidigungen fest. Die Gelöbnistradition der Bundeswehr geht auf die absolutistischen Söldnerheere zurück. Die Soldaten mußten auf den Kriegsherrn und die Kriegsartikel die Treue schwören. Mit der Einführung der Wehrpflicht änderte sich auch der Charakter des Eides. Während bei den Söldnerheeren der Eid noch den Charakter eines „freiwilligen“ Arbeitsvertrages hatte, wurde der Eid mit der Wehrpflicht zur Untertanenpflicht, mit dem der Soldat dem Landesherrn und dem „Vaterland“ ewige Treue schwor. Mit der Weimarer Republik setzte sich in Deutschland erstmals das liberale Bürgertum mit seiner Forderung durch, daß die Soldaten auf die demokratische Verfassung eines Staates ihren Eid ableisten. Im Nationalsozialismus wurde der Eid erneut geändert und verpflichtete von nun an den Soldaten zum unbedingten Gehorsam gegenüber Adolf Hitler. Eidbruch wurde mit dem Tode bestraft.
In der Bundesrepublik entbrannte nun erneut ein energischer Streit zwischen Reformern und Traditionalisten. Nur noch Zeit- und Berufssoldaten müssen heute den Eid auf die Bundesrepublik – nicht jedoch auf die Verfassung – ablegen. Die Wehrpflichtigen geloben hingegen „nur“. Traditionspflege und militärische Zeremonien zeigen allerdings deutlich den Widerspruch zwischen autoritär-obrigkeitsstaatlicher Vergangenheit und angeblich demokratischem Anspruch der Bundeswehr heute.
Die Bundeswehr out-of-area
Mit dem Zerfall des Warschauer Paktes befand sich die Bundeswehr in einer Legitimationskrise. Die Bundesrepublik ist umzingelt von Freunden, und ein Oderhochwasser kann auch vom Technischen Hilfswerk (THW) bekämpft werden. Auch deshalb arbeiten seit 1989 einflußreiche Kreise gezielt und erfolgreich an der Militarisierung bundesdeutscher Außenpolitik. Die Öffentlichkeit hat sich bereits an diese Politik gewöhnt und nimmt ihre Brisanz kaum noch zur Kenntnis. Etwa 10 Prozent des Bundeshaushalts gehen noch immer an das Verteidigungsministerium. Um dies angesichts der günstigen sicherheitspolitischen Lage zu rechtfertigen, mußten Militärs immer neue militärische Aufgaben ersinnen. In den entscheidenen Jahren 1991 – 1995 führte General Klaus Naumann die Bundeswehr zu neuen Ufern. Die Bundeswehr wurde von einer Verteidigungs- zur Interventionsarmee umgebaut. So wird unbemerkt von der Öffentlichkeit ein Fallschirmjägerverband bereits mit neuen Kriegstechniken ausgebildet: Dschungelkampf, Wüstenkampf und Polarkampf. Um all jene Tätigkeiten besser vermarkten zu können, heißen die neuen Aufgaben der Bundeswehr jedoch nicht mehr Kampfeinsätze, sondern beschönigend „Friedensmissionen“. Das Ziel heißt „weltweite Einsatzmöglichkeiten“, um die politischen, ökonomischen und geostrategischen Interessen der Bundesrepublik optimal zu verwirklichen. Mit dem Kosovo-Krieg ist auch dieses Ziel erreicht. Tausende von deutschen Soldaten auf dem Balkan, ohne daß dies zu einer nennenswerten Debatte über die deutsche Vergangenheit auf dem Balkan führt. Und selbst die Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an einem Luftangriff auf Belgrad – jener Stadt, die schon 1941 gänzlich von deutschen Bomben zerstört wurde – führte nicht zu einem Ansturm des Protestes.
Antirassismus
Kein Mensch ist illegal! Für die Legalisierung aller Illegalisierten! Gleiche Rechte für alle!
Illegalität in deutscher Produktion
In Deutschland leben nach offiziellen Schätzungen bis zu 1,5 Mio. „Illegale“, Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere also. Die realen Zahlen dürften weit darüber liegen. Die Gründe für die Illegalität sind vielfältig. Sie reichen von der Ablehnung als Asylbewerber, die illegale Einreise aufgrund der Chancenlosigkeit, Asyl zu bekommen, über abgelaufene und nicht verlängerte Papiere, bis hin zu Ausweisungen aufgrund von Verstößen gegen das Ausländergesetz oder das Asylverfahrensgesetz (z.B. gegen die Residenzpflicht). Viele Frauen und auch Männer werden plötzlich illegal, weil sie nach einer Scheidung keinen eigenen Aufenthaltstitel haben. Eine Vielzahl von Menschen lebt aber unter dem Mantel der „Scheinlegalität“. Das Touristenvisum ermöglicht ihnen die legale Einreise. Durch die Beschäftigung hier werden sie aber „Illegale“. Für die klassischen PendlerInnen ist es zudem notwendig, regelmäßig neu einzureisen, um ein neues Touristenvisum zu erhalten.
Diese hohe Anzahl von Menschen, die völlig rechtlos in der Bundesrepublik Deutschland leben, ist kein Zufall. Vielmehr ist sie die Folge der seit Jahren von Regierungen unterschiedlicher Couleur betriebenen Migrationspolitik, die besser als Illegalisierungspolitik zu beschreiben ist. So wurde mit der Asylgesetzänderung 1993 die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl beschlossen. Fluchtwege wurden systematisch kriminalisiert (3-Staatenregelung), die Legitimität von Flucht selbst durch die Definition „Sicherer Herkunftsstaaten“ weiter eingeschränkt. Hinzu kam die Verschärfung der Repression gegen Menschen, die dennoch nach Deutschland fliehen. Sie werden monatelang in Lagern an deutschen Flughäfen interniert. Statt ihnen zu ihrem Recht auf Asyl zu verhelfen, soll gerade das verhindert werden.
Die Abschottungspolitik der Europäischen Union tut ihr übriges. Die massive militärische Aufrüstung der EU-Außengrenzen wie z.B. der deutschen Ostgrenze, eröffnet eine regelrechte Jagd auf Flüchtlinge. Die EU-weit eingeführten Datenabgleichsysteme sorgen für die Erfassung aller Flüchtlinge mit dem Fluchtziel Europa und verhindern die Weiterflucht in ein anderes Land der Europäischen Union. Auch das rot-grüne Einwanderungsgesetz setzt die Politik der Illegalisierung von Flucht und Migration ungebrochen fort. In dem vorgelegten Entwurf wird die Abschaffung der Duldung festgeschrieben. Bisher Geduldete verlieren ihre Arbeitserlaubnis. Den Status der Duldung erhielten bislang vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge, die vorübergehend nicht abgeschoben werden konnten, Menschen mit ungeklärter Herkunft und Flüchtlinge, die Abschiebeschutz genießen. Nach Schätzungen von Pro Asyl können nur etwa 6% der ca. 250 000 Flüchtlinge mit Duldungsstatus einen ordentlichen Aufenthaltstitel erhalten. Die anderen 94 % werden systematisch in die Illegalität gedrängt. Der Entzug der Arbeitserlaubnis erhöht das Heer derer, die sich zwar legal in Deutschland aufhalten aber „Illegal“ hier arbeiten. Sie werden zu „Halb-Legalen“. Durch die geplante Ausweitung des Asylbewerberleistungsgesetz auf weitere Flüchtlingsgruppen (z B. Kriegsflüchtlinge, Kranke und Behinderte, Flüchtlinge mit Bleiberecht aufgrund Altfallregelung) wird die Situation der in Deutschland lebenden Flüchtlinge weiter verschlechtert und dürfte ebenfalls eine Ursache für das Abtauchen vieler in die Illegalität sein.
Überleben in der Kontrollgesellschaft
Die wesentliche Frage, ob und wieweit die Situation Illegalisierter gezielt benutzt oder gar erst geschaffen wird, um Arbeitsleistungen zu niedrigsten Löhnen abzupressen ‚lässt sich nicht eindeutig beantworten. Zunächst ist davon auszugehen, dass einige Wirtschaftssektoren nur über entrechtete bis illegale Arbeit aufrechtzuerhalten sind. Dazu zählen vor allem die Bauindustrie und Landwirtschaftsbetriebe, Restaurants und Gebäudereinigung, aber auch das Sexgewerbe und die Hausarbeit. Privatunternehmerische und staatliche Interessen scheinen dabei in der öffentlichen Diskussion bisweilen im Gegensatz zu stehen. Staatliche Behörden klagen über Steuerungsverluste, sie begreifen illegale Beschäftigung als Schutz und Nährboden weiterer illegale Zuwanderung‘, und nicht zuletzt besteht das Interesse, die ‘eigenen‘ Arbeitslosen und SozialhilfeempfängerInnen verstärkt in den Niedriglohnsektor zu zwingen. Dennoch dient die Hetze gegen Illegale“, „Schlepperbanden“ und „Schwarzarbeiter“ staatlichen Institutionen zur Durchsetzung weiterer Gesetzesverschärfungen. Die Illegalisierung von Flucht und Migration ist nur mit sicherheitspolitischen und polizeistaatlichen Mitteln durchsetzbar und wirkt sich so auf die Gesamtgesellschaft aus.
In Deutschland wird das überleben in der Illegalität durch die hohe Dichte an überwachungs- und Kontrollmechanismen die der‘. umfassenden Zugriff des Staates auf die hier Lebenden ermöglicht. zusätzlich erschwert. Angaben zum Wohnort und Arbeitsplatz, die Kranken- und Sozialversicherungsnummern, der Bezug von Sozialleistungen und selbst die Kfz-Zulassungen sind datentechnisch erfasst und zusammengeschlossen. Hinzu kommen spezielle „Ausländergesetze“, die wie die Residenzpflicht oder Chipkarten des Asylbewerberleistungsgesetzes den Tagesablauf von Flüchtlingen und MigrantInnen kontrollieren. Rassistische Gesichtskontrollen und die umfassende Kameraüberwachung im öffentlichen Raum sowie neue technische Möglichkeiten wie Gesichtsscannen etc, machen das heimliche überleben schwierig. Menschen ohne Papiere sind ausbeutbar und erpressbar. Sie arbeiten zu absoluten Dumpinglöhnen, sind nicht sozial- oder krankenversichert, haben kaum Chancen ihren Lohn gegen den Arbeitgeber einzuklagen. Zusätzlich leben sie täglich mit dem Risiko vom Chef oder von Kollegen angezeigt zu werden oder in eine der regelmäßig stattfindenden Polizeirazzien zu geraten. Die Suche nach einer Wohnung ist schwierig. Oft müssen Illegalisierte für einen Schlafplatz in einer heruntergekommenen Wohnung horrende Summen zahlen. Sie haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung.
„Illegale“ unterstützen, Legalisierung fordern!
Sowohl die Migrations- und Flüchtlingspolitik der BRD als auch die der Europäischen Union zielt auf die weitere Illegalisierung von Flüchtlingen. Antirassistische Politik muss diese Tendenz zur Kenntnis nehmen und in politische Forderungen münden lassen. Eine Politik, die gegen die zunehmende Entrechtung von Nicht-Deutschen und Nicht-EU-EuropäerInnen vorgehen will, muss in Zukunft auf drei Ebenen agieren. Zum einen ist die Unterstützung bestehender Netzwerke notwendig, die Illegalisierten das überleben ermöglichen. Zum anderen muss die Selbstorganisation von Betroffenen durch uns unterstützt und gestärkt werden. Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen, können die Flüchtlinge und MigrantInnen nur selbst. Sie dabei zu unterstützen, ist unsere Aufgabe. Die dritte Ebene muss die Forderung nach Legalisierung und vollen Rechten sein. Die Legalisierungsforderung darf dabei nicht als einmaliger Gnadenakt verstanden werden. Sie muss auf die Thematisierung der gesellschaftlichen Ausschließungsprinzipien zielen, spezielle Strafgesetze für AusländerInnen angreifen, die breite Erfassung verhindern, durch die die Gefahr der Abschiebung droht und das legale Leben an einem Wohnort freier Wahl mit der Zusicherung aller Rechte zum subjektiven Recht erheben. Nur so kann verhindert werden, dass Legalisierung selbst zum Ausschluss führt und nur einer kleinen Gruppe zugute kommt. Eine antirassistische Legalisierungskampagne zielt auf permanente Legalisierung in möglichst kurzen Abständen.
Kein Mensch ist illegal! Für die Legalisierung aller Illegalisierten! Gleiche Rechte für alle!
Illegalität in deutscher Produktion
In Deutschland leben nach offiziellen Schätzungen bis zu 1,5 Mio. „Illegale“, Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere also. Die realen Zahlen dürften weit darüber liegen. Die Gründe für die Illegalität sind vielfältig. Sie reichen von der Ablehnung als Asylbewerber, die illegale Einreise aufgrund der Chancenlosigkeit, Asyl zu bekommen, über abgelaufene und nicht verlängerte Papiere, bis hin zu Ausweisungen aufgrund von Verstößen gegen das Ausländergesetz oder das Asylverfahrensgesetz (z.B. gegen die Residenzpflicht). Viele Frauen und auch Männer werden plötzlich illegal, weil sie nach einer Scheidung keinen eigenen Aufenthaltstitel haben. Eine Vielzahl von Menschen lebt aber unter dem Mantel der „Scheinlegalität“. Das Touristenvisum ermöglicht ihnen die legale Einreise. Durch die Beschäftigung hier werden sie aber „Illegale“. Für die klassischen PendlerInnen ist es zudem notwendig, regelmäßig neu einzureisen, um ein neues Touristenvisum zu erhalten.
Diese hohe Anzahl von Menschen, die völlig rechtlos in der Bundesrepublik Deutschland leben, ist kein Zufall. Vielmehr ist sie die Folge der seit Jahren von Regierungen unterschiedlicher Couleur betriebenen Migrationspolitik, die besser als Illegalisierungspolitik zu beschreiben ist. So wurde mit der Asylgesetzänderung 1993 die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl beschlossen. Fluchtwege wurden systematisch kriminalisiert (3-Staatenregelung), die Legitimität von Flucht selbst durch die Definition „Sicherer Herkunftsstaaten“ weiter eingeschränkt. Hinzu kam die Verschärfung der Repression gegen Menschen, die dennoch nach Deutschland fliehen. Sie werden monatelang in Lagern an deutschen Flughäfen interniert. Statt ihnen zu ihrem Recht auf Asyl zu verhelfen, soll gerade das verhindert werden.
Die Abschottungspolitik der Europäischen Union tut ihr übriges. Die massive militärische Aufrüstung der EU-Außengrenzen wie z.B. der deutschen Ostgrenze, eröffnet eine regelrechte Jagd auf Flüchtlinge. Die EU-weit eingeführten Datenabgleichsysteme sorgen für die Erfassung aller Flüchtlinge mit dem Fluchtziel Europa und verhindern die Weiterflucht in ein anderes Land der Europäischen Union. Auch das rot-grüne Einwanderungsgesetz setzt die Politik der Illegalisierung von Flucht und Migration ungebrochen fort. In dem vorgelegten Entwurf wird die Abschaffung der Duldung festgeschrieben. Bisher Geduldete verlieren ihre Arbeitserlaubnis. Den Status der Duldung erhielten bislang vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge, die vorübergehend nicht abgeschoben werden konnten, Menschen mit ungeklärter Herkunft und Flüchtlinge, die Abschiebeschutz genießen. Nach Schätzungen von Pro Asyl können nur etwa 6% der ca. 250 000 Flüchtlinge mit Duldungsstatus einen ordentlichen Aufenthaltstitel erhalten. Die anderen 94 % werden systematisch in die Illegalität gedrängt. Der Entzug der Arbeitserlaubnis erhöht das Heer derer, die sich zwar legal in Deutschland aufhalten aber „Illegal“ hier arbeiten. Sie werden zu „Halb-Legalen“. Durch die geplante Ausweitung des Asylbewerberleistungsgesetz auf weitere Flüchtlingsgruppen (z B. Kriegsflüchtlinge, Kranke und Behinderte, Flüchtlinge mit Bleiberecht aufgrund Altfallregelung) wird die Situation der in Deutschland lebenden Flüchtlinge weiter verschlechtert und dürfte ebenfalls eine Ursache für das Abtauchen vieler in die Illegalität sein.
Überleben in der Kontrollgesellschaft
Die wesentliche Frage, ob und wieweit die Situation Illegalisierter gezielt benutzt oder gar erst geschaffen wird, um Arbeitsleistungen zu niedrigsten Löhnen abzupressen ‚lässt sich nicht eindeutig beantworten. Zunächst ist davon auszugehen, dass einige Wirtschaftssektoren nur über entrechtete bis illegale Arbeit aufrechtzuerhalten sind. Dazu zählen vor allem die Bauindustrie und Landwirtschaftsbetriebe, Restaurants und Gebäudereinigung, aber auch das Sexgewerbe und die Hausarbeit. Privatunternehmerische und staatliche Interessen scheinen dabei in der öffentlichen Diskussion bisweilen im Gegensatz zu stehen. Staatliche Behörden klagen über Steuerungsverluste, sie begreifen illegale Beschäftigung als Schutz und Nährboden weiterer illegale Zuwanderung‘, und nicht zuletzt besteht das Interesse, die ‘eigenen‘ Arbeitslosen und SozialhilfeempfängerInnen verstärkt in den Niedriglohnsektor zu zwingen. Dennoch dient die Hetze gegen Illegale“, „Schlepperbanden“ und „Schwarzarbeiter“ staatlichen Institutionen zur Durchsetzung weiterer Gesetzesverschärfungen. Die Illegalisierung von Flucht und Migration ist nur mit sicherheitspolitischen und polizeistaatlichen Mitteln durchsetzbar und wirkt sich so auf die Gesamtgesellschaft aus.
In Deutschland wird das überleben in der Illegalität durch die hohe Dichte an überwachungs- und Kontrollmechanismen die der‘. umfassenden Zugriff des Staates auf die hier Lebenden ermöglicht. zusätzlich erschwert. Angaben zum Wohnort und Arbeitsplatz, die Kranken- und Sozialversicherungsnummern, der Bezug von Sozialleistungen und selbst die Kfz-Zulassungen sind datentechnisch erfasst und zusammengeschlossen. Hinzu kommen spezielle „Ausländergesetze“, die wie die Residenzpflicht oder Chipkarten des Asylbewerberleistungsgesetzes den Tagesablauf von Flüchtlingen und MigrantInnen kontrollieren. Rassistische Gesichtskontrollen und die umfassende Kameraüberwachung im öffentlichen Raum sowie neue technische Möglichkeiten wie Gesichtsscannen etc, machen das heimliche überleben schwierig. Menschen ohne Papiere sind ausbeutbar und erpressbar. Sie arbeiten zu absoluten Dumpinglöhnen, sind nicht sozial- oder krankenversichert, haben kaum Chancen ihren Lohn gegen den Arbeitgeber einzuklagen. Zusätzlich leben sie täglich mit dem Risiko vom Chef oder von Kollegen angezeigt zu werden oder in eine der regelmäßig stattfindenden Polizeirazzien zu geraten. Die Suche nach einer Wohnung ist schwierig. Oft müssen Illegalisierte für einen Schlafplatz in einer heruntergekommenen Wohnung horrende Summen zahlen. Sie haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung.
„Illegale“ unterstützen, Legalisierung fordern!
Sowohl die Migrations- und Flüchtlingspolitik der BRD als auch die der Europäischen Union zielt auf die weitere Illegalisierung von Flüchtlingen. Antirassistische Politik muss diese Tendenz zur Kenntnis nehmen und in politische Forderungen münden lassen. Eine Politik, die gegen die zunehmende Entrechtung von Nicht-Deutschen und Nicht-EU-EuropäerInnen vorgehen will, muss in Zukunft auf drei Ebenen agieren. Zum einen ist die Unterstützung bestehender Netzwerke notwendig, die Illegalisierten das überleben ermöglichen. Zum anderen muss die Selbstorganisation von Betroffenen durch uns unterstützt und gestärkt werden. Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen, können die Flüchtlinge und MigrantInnen nur selbst. Sie dabei zu unterstützen, ist unsere Aufgabe. Die dritte Ebene muss die Forderung nach Legalisierung und vollen Rechten sein. Die Legalisierungsforderung darf dabei nicht als einmaliger Gnadenakt verstanden werden. Sie muss auf die Thematisierung der gesellschaftlichen Ausschließungsprinzipien zielen, spezielle Strafgesetze für AusländerInnen angreifen, die breite Erfassung verhindern, durch die die Gefahr der Abschiebung droht und das legale Leben an einem Wohnort freier Wahl mit der Zusicherung aller Rechte zum subjektiven Recht erheben. Nur so kann verhindert werden, dass Legalisierung selbst zum Ausschluss führt und nur einer kleinen Gruppe zugute kommt. Eine antirassistische Legalisierungskampagne zielt auf permanente Legalisierung in möglichst kurzen Abständen.
JungdemokratINNen/Junge Linke fordern deshalb
- Menschenrechte sowie sozial- und tarifrechtliche Standards müssen unabhängig vom Aufenthaltsstatus gewährt werden und einklagbar sein!
- Legalisierung aller in Deutschland lebenden Flüchtlinge und MigrantInnen!
- Keine Kriminalisierung von Flucht- oder Flüchtlingshilfe!
- Gleiche Rechte für alle!
Beschluss der 2. ordentlichen Landeskonferenz der JD/JL Berlin vom 23.02.2002
Bildungspolitik
Dem Rotstift entgegentreten – Bildungskahlschlag stoppen!
Die aktuellen Entwicklungen im Land Berlin im bildungspolitischen Bereich sind katastrophal. Ihnen gilt es vehement entgegenzutreten.
Als radikaldemokratischer Jugendverband haben wir selbstverständlich weitergehende Forderungen zur Demokratisierung des Bildungswesens, gerade deshalb lehnen wir die rückwärtsgewandten Umstrukturierungen des rot-roten Senats im Bildungsbereich ab.
- im vorschulischen Bereich wenden sich JD/JL Berlin insbesondere gegendie Erhöhung von KiTa-Gebühren, weil dadurch
- die außerfamiliäre Betreuung von Kindern von weniger Müttern und Vätern in Berlin in Anspruch genommen werden kann.
- insbesondere Frauen aus unteren und mittleren Einkommensschichten noch stärker an die Kinderbetreuung gebunden werden
- der Zugang zu außerfamiliärer Förderung aller Kinder gefährdet wird
- im schulpolitischen Bereich wenden sich JD/JL Berlin insbesondere gegen Regelungen und Tendenzen im neuen Schulgesetz wiedie teilweise Schulzeitverkürzung auf 12 Jahre, weil
- diese durch die Beibehaltung der 13 Schuljahre an Oberstufenzentren und Fachgymnasien und die Existenz eines Abiturs nach 12 und 13 Jahren an Gesamtschulen zu einer weiteren Selektionshürde durch die faktische Einführung eines Zweiklassenabiturs führt.
- eine Erhöhung der, insbesondere in der Oberstufe, zu bewältigenden Stoffdichte bedeutet und damit den Leistungsdruck auf Schüler weiter erhöht.
- sie zum größten Teil neoliberal, als Ermöglichung eines früheren Eintritts ins Erwerbsleben durch Verkürzung der Ausbildungszeit, begründet wird und so begleitende progressive Maßnahmen ausbleiben.
- die Aufnahme einer schulexternen Person mit Stimmrecht in die Schulkonferenz, wasmöglichen Sponsorunternehmen direkte Einflussmöglichkeiten an der Schule bietet.
- die weitere Entdemokratisierung der Schule durch die Aufhebung der Drittelparität in der Schulkonferenz durch die Einführung eines zusätzlichen Lehrervertreters und einer externen Person.
- im hochschulpolitischen Bereich wenden sich JD/JL Berlin insbesondere gegen die geplanten Kürzungen an den Unis, weil sie zur Folge hätten dass
- noch weniger ausfinanzierte Studienplätze an den Berliner Unis zur Verfügung stehen
- wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Angestellte entlassen werden oder auf tarifliche Lohnerhöhungen verzichten müssen
- ganze Institute geschlossen werden
- die Zulassungsbeschränkungen zu Studiengängen weiter verschärft werden wie beispielsweise steigende NCs
- die Einführung von Studienkonten jeglicher Art, weil sie
- als Studiengebühren sozial ausschließend sind, weil sie das Recht auf Bildung an die finanziellen Mittel der Studierenden koppeln
- selbstbestimmtes Studieren durch verschärfte Überwachung und verschärften Leistungsdruck noch weiter erschweren
- die Steuerung der Hochschullehre über Marktmechanismen beinhalten
- der problemlosen Ausweitung und Erhöhung von Studiengebühren Tür und Tor öffnen
- die weitere neoliberale Umstrukturierungen der Hochschulen, die
- kritische, selbstbestimmte und fachübergreifende Wissenschaften immer weiter einengen bzw. verunmöglichen
- die Ökonomisierung von Bildung weiter vorantreiben
Darum fordern wir konkret vom rot-roten Senat in Berlin
- im vorschulischen Bereich die ausreichende, kostenlose Bereitstellung von ganztägigen KiTa-Plätzen
- im schulpolitischen Bereich
- die Einführung der Gesamtschule als Regelschule
- Rückkehr zur Drittelparität in der Schulkonferenz
- die ausreichende staatliche Finanzierung der Schulen und das Verbot von Schulsponsoring
- den Ausbau der Rechte von Schülervertretungsgremien
- die kostenlose Bereitstellung aller für den Schulunterricht notwendigen Materialien insbesondere der Schulbücher
- Anerkennung einer satzungsautonomen LSV mit politischem Mandat
- im hochschulpolitischen Bereich
- die Ausfinanzierung von mindestens 135.000 Studienplätzen
- keinerlei Kürzungen an den Hochschulen
- das Verbot von Studienkonten und Studiengebühren
- die Viertelparität in allen universitären Gremien
- auf Bundesebene soll sich der rot-rote Senat
- für ein bundesweites Verbot von Studienkonten und Studiengebühren einsetzen
- für eine ausreichende, elternunabhängige und unbeschränkte Ausbildungsförderung für alle einsetzen und insbesondere Bestrebungen, das das höchst mögliche Eintrittsalter ins BAföG zu senken und die elternunabhängige Förderung zu streichen, entschieden entgegentreten
Beschluss der ersten Landeskonferenz 2004 der JD/JL Berlin
Bildungspolitik
Wir tragen das Kreuz nicht länger!
Zweimal die Woche heißt es: ab zum Religionsunterricht. Und zwar bis zum Eintritt in die Religionsmündigkeit – das ist mit 14 Jahren – zwangsweise, es sei denn es erklären sich die Erziehungsberechtigten mit einer Nicht-Teilnahme einverstanden.
Religionsunterricht
Wo kommt’s her?
Religionsunterricht in staatlichen Schulen gibt es in Deutschland nicht etwa erst, seit es die Bundesrepublik gibt. Am 20. Juli 1933 schlossen die nationalsozialistische Reichsführung und der Vatikan ein Abkommen, das sogenannte Reichskonkordat, ab, um die „bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu festigen und zu fördern.“ Damit ist „Reli“ als ordentliches Lehrfach, wie wir es heute kennen, eingeführt worden. Denn im Gründungsprozess der Bundesrepublik wurde den Religionsunterricht nicht etwa in Frage gestellt. Und deshalb ist nun in unserem Grundgesetz in Artikel 7 Absatz 3 zu lesen: „Der Religionsunterricht ist in öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt…“. Damit ist der Religionsunterricht das einzige im Grundgesetz verankerte Schulfach. Außerdem wird alles, was mit dem Religionsunterricht zu tun hat – Lehrplan, Lehrbuch und Lehrperson -, in Einvernehmen mit den Religionsgemeinschaften bestimmt. Damit haben sie auf einfachem Wege die Möglichkeit, staatlich finanziert junge Leute zu indoktrinieren.
Du sollst nicht…
Doch in Deutschland sind Staat und Kirche eigentlich voneinander getrennt. Dies bedeutet, dass der Staat sich nicht in das Handeln religiöser Zusammenhänge einmischen darf. Auch darf er seinen BürgerInnen nicht vorschreiben, ob und welcher religiösen Gruppe sie sich anschließen. Andersrum bedeutet diese Trennung, dass die Religionsgemeinschaften sich nicht direkt in das Handeln des Staates einmischen dürfen. Konkret werden heute jedoch Religionsgemeinschaften zum Beispiel bei Anhörungen gegenüber anderen sozialen Gruppen besser gestellt. Die Trennung von Staat und Kirche stellt sicher, dass alle BürgerInnen entscheiden können, was sie glauben möchten. Dabei ist es egal, ob es sich dabei um Buddha, Zeus oder gar nichts handelt. Auch wird sichergestellt, dass gläubige Menschen nicht nur zu Hause im Kämmerlein ihre Religion praktizieren können, sondern auch beispielsweise mit anderen zusammen religiös motivierte Feste feiern können. Dies ist möglich, da der Staat sich weltanschaulich neutral zu verhalten hat. Indem er sich nicht positioniert, urteilt er nicht über Religiöses und darf unterschiedliche Religionsgemeinschaften weder bevorzugen noch benachteiligen.
Im Falle des Religionsunterrichts – wie an vielen weiteren Punkten – subventioniert jedoch der Staat die großen Religionsgemeinschaften. Damit verhält er sich nicht neutral.
Auch werden die Ansichten von SchülerInnen nicht beachtet. Ein besonders anschauliches Beispiel ist die Einführung des Religionsunterricht in den neuen Bundesländern: Obwohl sich zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung nur weniger als 12% der SchülerInnen als „gläubig“ bezeichneten, wurde der christliche Religionsunterricht flächendeckend eingeführt.
Bremen und Berlin – Hochburgen der Ketzerei?
Ausnahmen stellen Berlin und Bremen dar. Denn in beiden Ländern gilt die so genannte „Bremer Klausel“. Sie besagt, dass in Berlin und Bremen Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes eben nicht gilt und damit Religionsunterricht kein ordentliches Lehrfach ist. Nichts desto trotz findet der Religionsunterricht in den Räumen der staatlichen Schulen statt. So haben die Religionsgemeinschaften die volle Kontrolle über den Religionsunterricht. Die SchülerInnen können entscheiden, ob sie an ihm teilnehmen wollen. Doch selbst dann, wenn die Religionsmündigkeit erreicht worden ist und die Eltern nicht mehr im Weg stehen, ist der Austritt aus dem Religionsunterricht mit Schwierigkeiten verbunden: Minderjährige SchülerInnen müssen beaufsichtigt werden oder es muss ein Ersatzunterricht belegt werden.
Deshalb fordern JungdemokratINNen/Junge Linke Berlin
- Schafft den Religionsunterricht ab!
- Die religiös und weltanschaulich neutrale Gesamtschule als staatliche Regelschule für alle!
- Radikale Trennung von Staat und Kirche!
Demokratie und Grundrechte
Für ein Verbot von Gen-Dateien und genetischen Fingerabdrücken
JungdemokratINNen/Junge Linke unterstützen Initiativen und Bündnisse, die sich gegen die Gen-Datei und den genetischen Fingerabdruck insgesamt, oder bestimmte Aspekte (z.B. mangelnden Datenschutz, konkretes Vorgehen bei der Entnahme von Körperzellen u.ä.) engagieren.
Insbesondere unterstützen JD/JL Betroffene (derzeit vor allem Strafgefangene) in der Wahrnehmung ihrer Rechte gegen eine Analyse und Speicherung ihrer DNA-Identifizierungsmuster.
JungdemokratINNen/Junge Linke fordern
- Die Änderung der Strafprozeßordnung vom 7. September 1998 (DNA-Identitätsfeststellungsgesetz) ist rückgängig zu machen.
- Alle existierenden DNA-Identifizierungsmuster, sowie die Gen-Datenbank des BKA sind unverzüglich zu löschen.
- Ein generelles gesetzliches Verbot der Erstellung von DNA-Identifizierungsmustern („Genetischer Fingerabdruck“) und deren Speicherung in einer sogenannten Gen-Datei.
- Ein generelles gesetzliches Verbot der Entnahme von Körperzellen und von Speichelproben, die der Erstellung von DNA-Identifizierungsmustern dienen, insbesondere in Form von Massentests.
Begründung
Was ist eigentlich die Gen-Datei?
Am Anfang der Geschichte zur Gen-Datei steht ein Wunder der Wissenschaft, das in Anbetracht der in die Humangenetik, insbesondere Projekte zur Entschlüsselung der DNA, gepumpten Forschungsmillionen gar kein Wunder ist. Jedenfalls ist es nach einhelliger Meinung der Experten möglich, aufgrund weniger Körperzellen eines Menschen (z.B. einem Blutstropfen, einem Stück Haar, einer Hautschuppe etc.) eine Gen-Analyse durchzuführen und daraus einen genetischen Fingerabdruck zu erstellen, der diesen Menschen unter Millionen endeutig indentifiziert (wieviele Millionen oder gar Milliarden es nun genau sind, darüber wird noch gestritten). Dieser „Abdruck“ läßt sich als eine Art Strichcode in einer Computerdatenbank abspeichern und kann dann elektronisch mit anderen verglichen werden. Für dieses Verfahren wird ein DNA-Strang verwendet, in dem sich nicht die eigentlichen Erbinformationen befinden – und aus dem sie sich bislang noch nicht „herauslesen“ lassen, aber das ist nach Meinung einiger Experten nur eine Frage der Zeit.
Das ist wichtig, weil so behauptet werden kann, es würden außer des Identifizierungsmerkmals keine personenbezogenen Informationen gewonnen und gespeichert. Daher auch der Vergleich mit einem Fingerabdruck, dem man ja auch nicht ansieht, wie die Person sonst aussieht oder welche Abstammung sie hat. Wie so oft, war nicht einfach wissenschaftliche Neugier der Antrieb zu dieser Entdeckung, son-dern vor allem die Idee, mit Hilfe solcher Verfahren ließe sich die Arbeit der Kriminalpolizei revolutionieren. Statt mühsam Indizien zu sammeln, oder in einem zeitraubenden Procedere Fingerabdrücke abzugleichen, genügt eine winzige Spur und eine ausreichend große Datenbank, um den Straftäter zu überführen – das ist die Hoffnung und deshalb floß das Geld in Strömen. Nachdem die technische Lösung gefunden war, fehlte dem Bundeskriminalamt (BKA) nur noch die rechtliche Grundlage, sie in die Praxis umzusetzen. Natürlich haben sie nicht so lange gewartet, bis ein entsprechendes Gesetz verabschiedet war, sondern gleich mal losgelegt: bereits 1993 wurde ein BKA-Beamter, der dem „Stern“ Unterlagen aus dem Fall „Bad Kleinen“ übermittelt haben soll, aufgrund des Speichels auf der Briefmarke wegen Geheimnisverrats verurteilt. Ohne gesetzliche Regelung wurden schon tausenden von Straftätern DNA-Proben entnommen, um bei Bedarf genetische Fingerabdrücke zu erstellen. Hunderte waren bereits beim BKA gespeichert. Für besondere öffentliche Aufmerksamkeit sorgten im vergangenen Jahr Massen-Gentests, mit deren Hilfe Sexualmörder gefaßt werden sollten. Das Thema „Sexualstraftäter“ und die vermeintlichen Erfolge des Verfahrens (entweder konnte kein Täter ermittelt werden, oder er hätte auch ohne so ein aufwendiges und ein paar hunderttausend Mark teures Verfahren gefunden werden können, da es z.B. der Nachbar war) trugen dazu bei, daß der Bundestag im September 1998 durch das „DNA-Identitätsfeststellungsgesetz“ dem Treiben eine gesetzliche Grundlage schaffen wollte.
Besagtes Gesetz ist jedoch weit davon entfernt, den rechtsstaatlichen Bedenken gegen die Gen-Datei Rechnung zu tragen. Stattdessen weitet es die Zielgruppe, deren genetische Codes in der Datenbank gespeichert werden sollten, weiter aus und ließ ansonsten fast alles ungeregelt. Jedes Bundesland hat dementsprechend eigene Vorstellungen davon, wie nun zu verfahren, was erlaubt und was verboten sei. Die aufgrund dieses Gesetzes an das BKA ergangene neue Errichtungsanordnung ist – wen wundert das eigentlich noch – geheim. Und die bundesdeutsche Öffentlichkeit ist an den Abbau fundamentaler rechtsstaatlicher Prinzipien inzwischen so gewöhnt, daß sich kaum wahrnehmbarer Protest in dieser ganzen Angelegenheit erhebt.
Einwände gegen die Gen-Datei
Die Einwände gegen eine solche Gen-Datei sind zahlreich und beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte des Verfahrens. Wir stellen sie geordnet nach Problemfeldern jeweils kurz vor.
Blinder Glaube an die Wissenschaft
Das Verfahren zur Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks erfordert spezialisierte wissenschaftliche Kenntnisse und Verfahren. Sie sind weder den Kriminalbeamten, die lediglich die Strichcodes abgleichen, noch sonst einem Normalbürger nachvollziehbar. Das die Codes eindeutig sind, müssen wir einfach glauben. Wissenschaft kann sich irren. Insbesondere bei Massentests ist die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums groß. Proben können verunreinigt oder vertauscht werden – niemand kann kontrollieren, ob die Wissenschaftler ordentlich gearbeitet haben.
Blinder Glaube an die Kriminalistik
Je aufwendiger die Fahndungsmethoden, desto größer ist die öffentliche Aufmerksamkeit und desto mehr steigt der Erfolgsdruck der Kriminalbeamten. Dieser Erfolgsdruck kann so groß werden, daß Beweise und Indizien manipuliert werden, wie jüngst im Fall O. J. Simpson. Oder zumindest wird es mit dem Zusammenhang der Indizien zur Tat nicht allzu genau genommen. Nicht immer läßt sich von Spuren am Tatort (z.B. eine Zigarettenkippe) auf den Täter schließen. Es können vorher ja noch andere dort gewesen sein. Doch wen interessiert das noch ange-sichts einer so „heißen Spur“, wenn einmal die Gen-Codes abgeglichen sind? Oder umgekehrt: wenn das BKA bei einem dringend der Tat verdächtigen den Abgleich vornimmt und feststellt, daß die Gen-Codes nicht identisch sind: wird es den Entlastungsbeweis bekannt machen, oder lieber Stillschweigen bewahren?
In jedem guten Fernsehkrimi wird noch vorgeführt, daß es zur Überführung eines Täters mehr braucht als eine Hautschuppe. Es muß ein Motiv gefunden, die Alibis müssen widerlegt und zusammenfassend eine plausible Geschichte rekonstruiert werden. Es gilt das Prinzip: in dubio pro reo, bis zum Beweis der Schuld ist der Verdächtige unschuldig. Mit zunehmender Technisierung der Polizeiarbeit wird dieses Prinzip schrittweise umgekehrt: der Verdächtige muß seine Unschuld beweisen, weil er eine bestimmte Ameise am Stiefel hatte, am falschen Ort geraucht hat, oder eine Stoffaser seines Lieblingspullis irgendwo gefunden wurde. Eine Kriminalistik, die sich nicht mehr um Motive und Alibis zu scheren braucht, mag zwar bequemer sein – in rechtsstaatlicher Hinsicht ist sie ein problematischer Rückschritt in die Zeit der Hexenprozesse.
Gravierende Regelungsmängel des Gesetzes
Das Gesetz regelt, bei wem Körperzellen zur Erstellung von DNA-Identifizierungsmustern ent-nommen werden dürfen: „dem Beschuldigten, der einer Straftat von erheblicher Bedeutung, insbesondere eines Verbrechens, eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, einer gefährlichen Körperverletzung, eines Diebstahls in besonders schwerem Fall oder einer Erpressung verdächtig ist […] wenn wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des Beschuldigten oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme besteht, daß gegen ihn künftig erneut Strafverfahren wegen einer der vorgenannten Straftaten zu führen sind“ oder „wenn der Betroffene wegen einer der […] genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt […] worden ist und die entsprechende Eintragung im Bundeszentralregister […] noch nicht getilgt ist“.
Diese Formulierungen lassen so viel Interpretationsspielraum, daß der Kreis der Betroffenen sich nahezu beliebig ausdehnen läßt. In einigen Bundesländern geht man bereits daran, alle Strafgefangenen, die wegen sogenannter Verbrechen (das sind alle Delikte, die mit mindestens einem Jahr ohne Bewährung bestraft werden) einsitzen, systematisch zu erfassen. Die Justizministerien der Länder rätseln bereits, was Straftaten „von erheblicher Bedeutung“ sind. Fast je-der, der nicht gerade ein Bagatelldelikt begeht, ist in dieser breiten Definition unterzubringen. Auch mit der Annahme der zu erwartenden erneuten Ermittlungen ist man, wie die Praxis be-reits zeigt, schnell bei der Hand: in einigen Strafanstalten wurden erstmal alle „Mörder“ (in der Sprache des StGB) zur Genprobe beordert – „Mörder“ haben bekanntlich eine sehr niedrige Rückfallquote. Außerdem regelt das Gesetz, daß DNA-Identifizierungsmuster vom BKA gespeichert werden dürfen und „nach dem Bundeskriminalamtsgesetz verarbeitet und genutzt werden“ können. Desweiteren dürfen daraus Auskünfte „für Zwecke eines Strafverfahrens, der Gefahrenabwehr und der internationalen Rechtshilfe hierfür erteilt werden“. Im Klartext: wie die Daten gespei-chert und verarbeitet werden, mit welchen anderen Daten sie kombiniert, an wen sie schließlich übermittelt und wofür sie eingesetzt werden ist weitgehend Sache des BKA und das übt über solche Dinge bekanntlich Geheimhaltung. Dient nicht irgendwie alles, was das BKA tut, der Gefahrenabwehr? „Beschuldigter“ kann ohnehin prinzipiell jeder werden, der einmal zur falschen Zeit am falschen Ort ist.
Das erste, was das Gesetz überhaupt nicht regelt, ist, was nach dem Freispruch eines erstmal Beschuldigten mit seinen Daten passiert. Kein Wort dazu, ob oder wann sie gelöscht werden. Laut der vor dem Gesetz gültigen Errichtungsanordnung wurde nur gelöscht, wenn der Freispruch aus „erwiesener Unschuld“ erfolgte. Bei einem Freispruch aus „Mangel an Beweisen“ konnte weiter gespeichert werden. Ebensowenig legt das Gesetz fest, ob man darüber informiert wird, daß überhaupt entsprechende Daten gespeichert sind. Lediglich die entnommen Körperzellen „sind unverzüglich zu vernichten“, sobald sie für die DNA-Analyse nicht mehr erforder-lich sind. Über die Löschung der Daten selbst kein Wort. Wie die Entnahme durchzuführen ist, regelt das Gesetz auch nicht. Reicht das Einverständnis des Betroffenen? Braucht man eine richterliche Anordnung? Wenn ja, von welchem Richter? Wird man angehört? Kann man Widerspruch einlegen? usw. usf.
Bei den nur ein Jahr zuvor in die StPO eingefügten §§ 81e und 81f („Molekulargenetische Un-tersuchung“) nahm man es mit solchen Fragen noch wesentlich genauer. Doch diese Regelungen beziehen sich nicht auf die Errichtung einer Datenbank und lassen daher alle diesbezügli-chen Fragen offen. Rechtspolitisch ist das DNA-Identitätsfeststellungsgesetz auch im Kontext der allgemeinen Tendenz zur fatalen Vermehrung unbestimmter Rechtsbegriffe zu bewerten, in die es sich nahtlos einfügt. Abgesehen vom juristischen Sprachduktus könnte das Gesetz genausogut lauten: „Macht mal, ist schon in Ordnung“.
Datenschutzprobleme
Aus den genannten Unklarheiten über die Art der Speicherung, Weitergabe und fehlende Regelungen zur Löschung der Daten ergeben sich erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken. Insgesamt ist neben dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit das Grundrecht auf (informationelle) Selbstbestimmung tangiert, wenn in diesem Umfang gegen den Willen der Betroffenen personenbezogene Daten gespeichert werden. Die im Gesetz (anhand der Charakterisierung der erforderlichen Straftaten) erwähnten Rechtsgüter können einen so fundamentalen Eingriff in die Grundrechte keinesfalls pauschal rechtfertigen. Mindestens bedürfte es transparenter und klarer Bestimmungen zur Aufklärung der Betroffenen, was mit ihren Daten passiert.
Wozu sich das noch alles verwenden läßt
Der kontinuierliche Ausbau kriminalpolizeilicher Kontroll- und Fahndungsbefugnisse läßt annehmen, daß die aktuelle Regelung nur den ersten Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Gen-Datei ist, die zu immer mehr Zwecken eingesetzt werden kann. Der Kreis der erfaßten Personen ist durch das Gesetz schon weit gefaßt, läßt sich aber leicht noch auf andere Personengruppen ausdehnen (wir ersparen uns eine Liste der „üblichen Verdächtigen“, um die Phantasie der Sicherheitspolitiker nicht zusätzlich anzuregen). Im Zuge von Rasterfahndungen und Jedermannskontrollen ohne Tatverdacht lassen sich unzählige Datenabgleiche ausdenken. Die Formel ist immer dieselbe: „Wer sich nichts zuschulden kommen läßt, hat nichts zu befürchten“. Warum also nicht von jedem gleich bei Geburt oder Einreise den genetischen Fingerabdruck machen?
Die Wissenschaft arbeitet derweil weiter an der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Angeblich wird man in ein paar Jahren auch aus dem zur Erstellung des genetischen Fingerab-drucks verwendeten DNA-Strang die Erbinformationen auslesen können. Besonderes Interesse gilt dabei der Hoffnung, irgendwann ein sogenanntes „Verbrecher-Gen“ zu finden. (Dazu gibt es schon zahlreiche Bücher, inklusive Phantasien zum Umgang mit den schon als Baby zum Verbrecher gestempelten Personen…)
Kriminalpolitisches
Eine Gen-Datei ist teuer, unnütz, verstößt gegen Grundrechte und fördert fragwürdige Ermittlungsmethoden und geheimdienstliche Praktiken, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unterhöhlen. Die Vorstellung, durch immer neue technische Ermittlungsverfahren und riesige Daten-sammlungen ließen sich Straftaten verhindern, ist ein kriminalpolitischer Irrglaube. In einigen Fällen fördert der zunehmende Kontrolldruck und die Verschärfung des Strafrechts eher Exzesshandlungen der Täter, die sich z.B. durch Waffengebrauch der Verfolgung entziehen wollen. Aus einem Bankraub wird so schnell eine Geiselnahme. Es gibt wenig Anlaß anzunehmen, die Technisierung sozialer Kontrolle sei insgesamt ein geeigneter und vertretbarer Weg, Straftaten zu verhindern. Das gilt umso mehr, als fortschrittliche Alternativen im politischen Diskurs mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Überfüllte Gefängnisse sind bekanntlich kein Beitrag zur Kriminalprävention. Die USA bieten in dieser Hinsicht ein abschreckendes Beispiel. Doch angesichts medienwirksamer Inszenierungen des „harten Durchgreifens“ sind Vorschläge zur Entkriminalisierung und alternativen Umgangsformen mit Straftaten für den populären politischen Diskurs unattraktiv geworden.
Genetische Fingerabdrücke auch ohne Datei ein Problem
Aufrechte Liberale, die ihren Glauben an den hiesigen Rechtsstaat noch nicht gänzlich verloren haben, könnten jetzt fragen, warum es denn nicht ausreiche, die Einrichtung von Gen-Dateien zu verbieten, während der genetische Fingerabdruck an sich unter kontrollierten rechtsstaatlichen Bedingungen zur Verhinderung schwerster Straftaten doch eigentlich unterstützenswert sei. Diese Sichtweise ignoriert sowohl die Bedeutung der auch in dieser Variante fortbestehenden Einwände, als auch die typische Dynamik der schrittweisen Ausweitung vergleichbarer sicherheitsstaatlicher Befugnisse.
Auch ohne Datei bleibt der genetische Fingerabdruck ein kriminalpolitisch bedenkliches Instrument, das auf falschen Vorstellungen von wissenschaftlicher Exaktheit und kriminalistischer Sorgfalt beruht. Insbesondere bei der Verfolgung von Straftaten sind dem Staat aus gutem Grund Grenzen gesetzt, um Bürgerrechte zu schützen. Der „Kampf gegen das Verbrechen“ richtet sich in Wahrheit gegen die Demokratie. Die Geschichte der Ausweitung sicherheitsstaatlicher Befugnisse vom „Telefon-Abhörgesetz“ über „OK-Gesetz“ und „Großer Lauschangriff“ zu „Rasterfahndung“ und „Jedermannskontrollen“ hat immer wieder gezeigt, daß jede Einschränkung der Bürgerrechte nur ein Schritt auf dem Weg zu immer mehr Überwachung war, dem unweigerlich der nächste Schritt folgte. Und sie hat gezeigt, daß Maßnahmen, die angeblich der Verbrechensverhütung dienen, sich zunehmend gegen alle Bürgerinnen und Bürger richten.
Jeder weitere Schritt auf diesem Weg ist ein Schritt zu viel!
Antrag des BAK Grund- und Freiheitsrechte zur BDK 1999
Demokratie und Grundrechte
Warum wir ein Volksbegehren zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses nicht unterstützen
Die Frage der politischen Ausrichtung
Die Situation in Berlin ist beschissen und die Politik des rot-roten Senats macht Widerstand an vielen ganz konkreten Punkten notwendig – seien es die zahlreichen Sparmaßnahmen im Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich oder sei es die fortgesetzte Lohnkürzungs- und Privatisierungspolitik, sei es der Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag oder die noch immer nicht ausgestandene Diskussion um Studienkonten und -gebühren. Gegen all diese Verschärfungen und unsozialen Maßnahmen sind organisierter Protest und Widerstand aller Betroffenen unvermindert geboten.
Dass sich Berlin in einer Haushaltsnotlage befindet, bestreitet niemand. Doch das verbissene Festhalten des rot-roten Senats am Dogma der Haushaltskonsolidierung durch Kürzungen und Privatisierungen wird der Stadt und ihren Bewohnern weder kurz- noch längerfristig Gutes bescheren. Mit dem Totschlagargument „Sachzwang“ wird kaputtgespart und verscherbelt und ein glückliches Ende dessen ist auch für Sarrazin und Co. nicht in Sicht, eine Entschuldung Berlins aus eigener Kraft ist und bleibt undenkbar.
Neoliberale Politikvorstellungen sind aber kein auf Berlin begrenztes Problem, sondern schlagen uns von allen Seiten entgegen. „Sachzwänge“ diktierten „Reformen“ die nötig seien um Berlin/Deutschland/Europa wieder „zukunfts- und wettbewerbsfähig“ zu machen. Im Klartext sind das eine „Gesundheitsreform“, die medizinische Versorgung für die große Mehrheit der Bevölkerung verschlechtern und verteuern wird, eine erneute „Rentenreform“, die dazu führt, dass die Renten 2004 zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik sinken und die Altersarmut in absehbarer Zeit erheblich zunehmen wird, eine „Arbeitsmarktreform“, die drastische Kürzungen bei den Unterstützungsleistungen mit zunehmendem autoritärem Druck verbindet, und eine „Steuerreform“, die Entlastungen in erster Linie für Unternehmen und Bezieher von höheren Einkommen, Kapitalerträgen und Spekulationsgewinnen bringt.
Diese Maßnahmen entstammen nicht der Feder des rot-roten Senats, sondern der rot-grünen Bundesregierung, mit kräftigem Rückenwind der schwarz-gelben Opposition, der die Richtung gefällt und der nur die Schritte zu klein sind. Natürlich hat der rot-rote Senat im Bundesrat nichts unternommen, um diese Politik zu verhindern. All diese Reformen treffen natürlich auch die Berliner.
Hinzu kommt die Berliner Haushaltslage – eine so extrem hohe Verschuldung, dass sich Berlin keinesfalls aus eigener Kraft daraus befreien kann. Die Entschuldung Berlins kann nicht gelingen wenn keine bundespolitische Lösung gefunden wird. Nötig ist eine Steuerpolitik des Bundes, die durch eine gerechtere Verteilung der Belastungen mehr Einnahmen erzielt, die letztlich den Ländern und Kommunen zugute kommen. Ideen gibt es genug: Die Reform von Einkommens- und Körperschaftssteuer, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und der Börsenumsatzsteuer…
Solange es keine Entlastung der Kommunen durch eine gerechte Steuerpolitik des Bundes gibt und Berlin nicht entschuldet wird, bleibt jedem Berliner Senat nur die Verwaltung der Haushaltsnotlage. Auch einzelne Ideen, wie die Einnahmen Berlins auch auf kommunaler Ebene erhöht werden könnten, ändern daran nichts.
Widerstand gegen die Berliner Verhältnisse muss sich also immer auch gegen die Bundesregierung richten. Es bedarf eines breiten organisierten Protests gegen das Ausbluten der Kommunen. Ein kurzfristig aktionistisches Volksbegehren zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses verstellt dagegen den Blick auf diese Zusammenhänge und erweckt vielmehr den Eindruck, es müssten nur die „Richtigen“ im Roten Rathaus sitzen, dann würde schon alles gut in Berlin. Es ist aber eben keine Frage der „richtigen Leute“, sondern des politischen Handlungsrahmens, der im Zuge dieses Volksbegehrens höchstens am Rande zur Sprache kommen kann, statt Schwerpunkt des Widerstands zu sein.
Die Frage der faktischen Durchführung
Wir teilen nicht die Einschätzung, dass das Volksbegehren zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses eine Chance auf Erfolg hat. Dass es allein ausreichen soll, „denen da oben mal unseren Unmut zu bekunden“ um die Hälfte der wahlberechtigten Berliner zur Abstimmung und mehr als ein Viertel aller Berliner Wahlberechtigten zu einem „Ja“ zur Beendigung der Wahlperiode zu bewegen, ist nicht einsichtig.
Auch der erhoffte Nutzen eines erfolgreichen Volksbegehrens zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses überzeugt da nicht. Eine politische Alternative ist nicht zu erwarten, und ein „symbolischer Sieg gegen unsoziale Politik“ wird niemanden vor ihrer Fortsetzung bewahren. Den vagen Nutzen einer so symbolischen Politik scheint uns die Gefahr der Schwächung der außerparlamentarischen Bewegung durch ein Scheitern des Volksbegehrens enorm zu überwiegen.
Und nicht nur ein Scheitern des Volksbegehrens würde die Berliner außerparlamentarischen Kräfte schwächen, sondern auch dessen Durchführung: Auf der einen Seite werden Kräfte von den geplanten inhaltlichen Kampagnen abgezogen werden müssen, andererseits steht zu befürchten, dass diese Kampagnen trotz inhaltlicher Übereinstimmung nur dann unterstützt werden können, wenn die Gretchenfrage „wie hältst du’s mit dem Volksbegehren?“ mit „dafür“ beantwortet wird. Mit einem solchen Vorgehen ohne politische Alternative werden zudem die existierenden kritischen und fortschrittlichen Kräfte in bzw. im Umfeld von SPD und PDS nicht unterstützt, sondern gespalten und damit geschwächt.
All diese Gefahren sehenden oder gar zweifelnden Auges in Kauf zu nehmen ist nicht nur leichtsinnig, sondern sogar gefährlich!
Die Frage nach den nächsten Schritten
Der Protest gegen Sozialabbau, Kürzungs- und Privatisierungspolitik muss unvermindert weitergehen – ein Volksbegehren zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses ist kein Schritt in diese Richtung.
Die Alternative zu einem Volksbegehren sind für uns klare inhaltliche Kampagnen, zum Beispiel
- eine Kampagne zur Entschuldung Berlins.
- eine Antiprivatisierungskampagne gegen die Senatspläne zu Vivantes und BVG.
- die Weiterführung der Kampagne zur Einführung eines Sozialtickets zum Preis von 10€.
All diese Punkte bieten genügend Stoff um zum einen den rot-roten Senat für seine unsoziale und perspektivlose Spar- und Privatisierungspolitik in den Arsch zu treten und gleichzeitig klar zu machen, dass der Bund in der Pflicht steht.
Zugleich gibt es Punkte, die der Senat, trotz großer Versprechungen im Koalitionsvertrag noch immer nicht umgesetzt hat – wie die längst überfällige Durchsetzung der Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte und der Abschaffung des Chipkartensystems auch in den Bezirken. Der Wiedereintritt des Landes Berlin in den Bund der kommunalen Arbeitgeber ist eine weitere Forderung, der sich der Senat allein zu stellen hat.
Zudem bleibt die Aufgabe bestehen, Wege der politischen Umsetzung der Forderungen der außerparlamentarischen Linken zu entwickeln. Ein Volksbegehren zur Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses dient diesem Ziel in der derzeitigen Situation nicht.
Beschluss des Landesvorstandes der JD/JL-Berlin vom 11. Mai 2004
Stadtpolitik
Zur gewaltsamen polizeilichen Räumung der Liebig 14
Erklärung der JungdemokratInnen/Junge Linke Berlin zur gewaltsamen polizeilichen Räumung der Liebig 14 am 02.02.2011
JD/JL Berlin verurteilen die polizeiliche Räumung des Liebig 14 am 02.02.2011 und rufen dazu auf sich der neoliberalen Politik, welche sich nur an Verwertungslogiken orientiert, kreativ zu widersetzen.
Die Liebig 14 war ein weiteres alternatives Hausprojekt in Berlin, welches geräumt wurde. Die gewaltsame Räumung ist eine wiederholte Eskalation im Konflikt um steigende Mieten und Stadtumstrukturierung und keineswegs nur die Folge eines privatrechtlichen Konflikts zwischen vermeintlichen Besetzer_innen und dem Eigentümer Suitbert Beukler. Im Rahmen der seit den 1990er Jahren betriebenen Wohnungsprivatisierung des Berliner Senats, wurde das Gebäude der Liebig 14 an Beukler verscherbelt und damit der politische Konflikt vermeintlich privatisiert.
Seitdem hat das Land Berlin verstärkt auch andere kommunale Betriebe, Häuser und Flächen meistbietend verkauft. Das Ziel war einzig die Profitmaximierung und Aufbesserung des Landeshaushaltes mit dem Ergebnis, dass die öffentliche Daseinsfürsorge privatisiert und politische Steuerungsmechanismen bewusst verspielt wurden. Doch auch unabhängig von dieser selbstverschuldeten Situation lässt der Senat ein Bemühen um ausgeglichene Lösungen für die entstandenen Raumnutzungskonflikte missen. Möglichkeiten der politischen Einflussnahmen werden nicht genutzt. Der Senat trägt somit die politische Verantwortung für die Verdrängung und Gentrifizierung der Stadt.
Die neoliberale Umstrukturierung der Stadt schließt ganz bewusst demokratische Mitgestaltungsmöglichkeiten aus und operiert lediglich nach dem Kriterium der kapitalistischen Verwertbarkeit. Diejenigen, welche als nonkonformistisch identifiziert werden und sich nicht verwerten lassen (wollen), werden mit allen Mitteln aus den Kiezen verdrängt. Die Verdrängung erfolgt häufig in Form von unbezahlbaren Mieten, polizeilichen Räumungen, verstärkter Überwachung und der Kommerzialisierung öffentlicher Plätze. Die Stadt Berlin möchte sich in der öffentlichen Vermarktung als kreative, innovative und weltoffene Stadt präsentieren; leider ist dies nur Fassade. Tatsächlich findet schon seit längerem eine Homogenisierung, Kommerzialisierung sowie soziale Verdrängung von Menschen statt, welche sich dieses hippe und stylische Image nicht leisten können oder wollen.
Wir als JD/JL Berlin sehen diese Entwicklungen mit großer Sorge und einer wachsenden Wut! Der Senat und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung setzen diesen Entwicklungen nicht nur nichts entgegen, sondern leisten diesen Vorschub, wie am Beispiel vom Flughafen Tempelhof, der Räumung vom York59 und vielen anderen Kristallisationspunkten deutlich wurde. Wir verlangen eine radikale Abkehr von einer Stadtpolitik, die sich nur an kapitalistischen Verwertungskriterien orientiert und rufen alle dazu auf, sich dieser neoliberalen und menschenverachtenden Politik auf kreative Weise zu widersetzen.
Die Stadt gehört allen!
JungdemokratInnen/Junge Linke Berlin im Februar 2011
Wirtschaft und Soziales
Dem Rotstift entgegentreten – Sozialabbau stoppen!
Zur Zeit findet in Berlin ein Sozialabbau in einem Ausmaß statt, das die Stadt bisher nicht kannte. Die Schuldensituation ist erdrückend: Das Land Berlin hat Gesamtschulden in Höhe von 50 Milliarden Euro, die jährlichen Ausgaben liegen 6,3 Mrd. Euro über den jährlichen Einnahmen. Die Zinslast beträgt 3,4 Mrd. Euro jährlich. Allein die Ausgaben, zu denen das Land Berlin gesetzlich verpflichtet ist, überschreiten die Einnahmen beträchtlich.
Die von verschiedenen linken Gruppen vorgeschlagenen Konzepte kommunale Einkommenssteuer oder Auflösung der Bankgesellschaft Berlin können die Haushaltskrise nicht lösen. Nur durch die Heranziehung des gesellschaftlichen Reichtums wird eine Verbesserung der verheerenden Haushaltssituation möglich. Eine solche Politik ist auf Landesebene aufgrund der rechtlichen Situation nicht durchführbar, hier ist die Bundesebene gefragt. Zu fordern ist:
Veränderung der Steuerpolitik in der Bundesrepublik hin zu einer Politik, die effektiv den privat angeeigneten gesellschaftlichen Reichtum abschöpft und von „oben“ nach „unten“ umverteilt.
Dennoch kann von einem rot-roten Senat und insbesondere der PDS auch unter diesen Bedingungen eine andere Politik verfolgt werden. Auf Bundesebene gälte es, sich beispielsweise für die Forderung nach einer Vermögenssteuer, der Erhöhung der Erbschaftssteuer und höhere Besteuerung von Unternehmensgewinnen einzusetzen. Doch auch auf Berliner Ebene hätte der Senat Spielraum für linke Politik: Zum einen gibt es Politiken, die kostenneutral wären, aber dennoch geeignet, ein linkes Profil dieser Regierung zu zeigen. Die wenigen positiven Beispiele, wie die überfällige Wiederverleihung der Ehrenbürgerwürde an den ersten Stadtkommandanten von Berlin, Nikolai Bersarin, oder auch Wohnungsunterbringung und Bargeldauszahlung für die vom Land Berlin versorgten Flüchtlinge müssen und können durch weitere Schritte ergänzt werden. Denkbar wären: die Einführung der längst vereinbarten Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte bei geschlossenen Einsätzen, die Ablehnung öffentlicher Gelöbnisse, Schritte in Richtung der Drogenlegalisierung.
Skandalös ist jedoch, dass die Politik des Senats durch Kürzungen, die einfach unerträglich sind, gekennzeichnet ist. Zu nennen sind hier vor allem der rechtswidrige Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag, mit dem sich der Senat zum Vorreiter neoliberaler Politik gemacht hat und der Versuch, dass Sozialticket abzuschaffen, wodurch der Senat den Schwächsten der Schwachen noch die Grundlagen zum Überleben wegkürzt. Im Bildungsbereich wurden die KiTa-Gebühren erhöht und 75 MioEuro Kürzungen an den Hochschulen durchgedrückt.
Diese Kürzungen sind in ihren konkreten Auswirkungen verheerend, viel schlimmer ist jedoch die politische Botschaft, die von dieser Politik ausgeht: TINA (there is no alternative) – Es gibt keine Alternative zur neoliberalen Politik, nicht mal die Linke hat eine. Die Ausweitung der Videoüberwachung in öffentlichen Räumen zeigt, dass auch unabhängig von Kostenüberlegungen neoliberale Politik von der PDS mitgetragen wird.
Die Aufgabe von JungdemokratInnen/Junge Linke als linker parteiunabhängiger Jugendverband besteht in dieser Situation darin, die Proteste in Berlin nach Kräften zu unterstützen, die Vernetzung der verschiedenen von Kürzungen betroffenen Gruppen voranzutreiben und linke Alternativen zur herrschenden Politik aufzuzeigen.
JungdemokratINNen/Junge Linke fordern
- Keine Kürzungen in den Bereichen Bildung, Jugend, Soziales und Kultur! Rücknahme der schon beschlossenen Kürzungen in diesen Bereichen, insbesondere sofortige Wiedereinführung des Sozialtickets zum Preis von 10 € und Wiedereintritt des Landes Berlin in den Verband öffentlicher Arbeitgeber!
- Eine Bundesratsinitiative des rot-roten Senats für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, wie im Koalitionsvertrag festgehalten!
- Gemeinsamer Widerstand aller von Kürzungen betroffener Gruppen!
Beschluss der ersten Landeskonferenz 2004 der JD/JL Berlin
Wirtschaft und Soziales
GATS stoppen: Public services under public control!
Mit den gegenwärtigen Verhandlungen zum Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services) wird die rücksichtslose Liberalisierung des Handels durch die Welthandelsorganisation WTO weiter vorangetrieben.
Das GATS ist ein wichtiger Bestandteil dieser neoliberalen Globalisierung im Dienste der Herstellung eines Weltmarktes mit nie kaum noch beschränkter Mobilität des Kapitals. In den 90er Jahren drehten sich die Verhandlungen v. a. um Deregulierung derjenigen Dienstleistungssektoren, die in der Vergangenheit von nationalen Monopolen beherrscht wurden: Telekommunikation, Finanzdienstleistungssektor, Tourismus, Medien, Post, Bahn, Elektrizität. Bis Ende Juni 2002 mussten alle WTO-Mitglieder im Zuge einer zweiten Verhandlungsrunde ihre Marktöffnungsforderungen („requests“) übermitteln. Ende März 2003 sind all jene Bereiche zu benennen, die die Mitgliedsländer selbst zu liberalisieren bereit sind („offers“)“. Auf Grundlage dieser Forderungen und Angebote werden dann neue, erweiterte GATS-Verpflichtungen ausgehandelt, die im Januar 2005 in Kraft treten sollen. (Für die EU-Mitgliedstaaten führt die Europäische Kommission die GATS-Verhandlungen, wobei auf deutscher Seite das Bundeswirtschaftsministerium federführend ist.)
In der aktuellen Verhandlungsrunde geht es vor allem um bislang noch „geschützte“ öffentliche Einrichtungen bzw. Grundgüter des Lebens – Wasser, Bildung, Gesundheit, Altersvorsorge und Kultur. Entgegen anders lautender Beteuerungen von Bundesregierung und EU-Kommission sieht der GATS-Text eine Ausnahme für „hoheitlich erbrachte Dienste“ nur dann vor, wenn sie „weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern“ erbracht werden. Aber: in bestimmt 90 Prozent aller Länder existieren neben staatlichen Schulen, Universitäten, Krankenhäusern etc. auch ein paar private Einrichtungen, die in diesen Bereichen ihre Dienste anbieten. Es ist also davon auszugehen, dass grundsätzlich kein Dienstleistungssektor vom GATS ausgenommen ist. Es ist lediglich eine Frage der Interessen der einzelnen WTO-Mitglieder sowie des politischen Drucks, welche Bereiche inwieweit dann auch praktisch zum Gegenstand der Verhandlungen werden und wo die Bestimmungen des GATS-Vertrages schlussendlich auch politisch-juristisch durchgesetzt werden.
Grundprinzipien der WTO und somit auch des GATS sind: Handelsvorteile für ein Land gelten automatisch auch für alle anderen Mitgliedsländer („Meistbegünstigungsklausel“) und ausländische Anbieter sind z.B. hinsichtlich des rechtlichen Rahmens, nötiger Genehmigungen, eventueller Subventionen usw. genau wie inländische zu behandeln („Nichtdiskriminierungsgebot“). Der Vertrag zielt darauf ab, alle Einschränkungen, die als „Handelshemmnis“ interpretiert werden können, abzubauen, um dadurch einen effektiven Marktzugang zu erreichen. Die besondere Brisanz liegt dabei darin, dass Dienstleistungsmärkte weniger durch klassische Handelshemmnisse wie Zölle geschützt werden, sondern vor allem durch innerstaatliche Regelungen und Normen wie Bauvorschriften, Zulassungsverfahren, Umwelt- und Gesundheitsschutzbestimmungen oder Arbeits- und Sozialstandards. Von besonderer Bedeutung ist hier, dass die WTO auf dem Konzept sog. „like products“ basiert. Dies bedeutet, dass für den Marktzugang von Waren und Dienstleistungen grundsätzlich unerheblich ist, wie diese hergestellt bzw. erbracht werden. Zudem werden durch das GATS nationale Arbeits-, Sozial- oder Umweltstandards ausgehebelt, ohne dass auf globaler Ebene gleichwertige Regelungen treten würden. Ob eine Leistung durch Kinderarbeit oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen erbracht wird, ist egal, wenn nur das Produkt betrachtet wird. Was droht, ist ein Unterbietungswettlauf durch unterschiedliche arbeits-, sozial-, umweltrechtliche Normen. Gewerkschaften setzen sich deshalb u. a. dafür ein, dass ausländische ArbeitnehmerInnen mindestens zu den gleichen Bedingungen beschäftigt werden, die für Einheimische gelten. Sie dürfen also weder geringer entlohnt noch schlechter gegen soziale Risiken abgesichert werden.
Findet die neoliberale Wettbewerbsideologie konsequente Anwendung, müssen Privatanbietern zudem Mittel in gleicher Höhe wie öffentlichen Einrichtungen gewährt werden. Damit steht eine bevorzugte staatliche Unterstützung für öffentliche Theater, Bibliotheken und Museen ebenso zur Disposition wie die bevorzugte Finanzierung von staatlichen Schulen und Universitäten.
GATS: Liberalisierung ohne Ende!
Die Liberalisierung des Welthandels wird vor allem von den wirtschaftlich starken kapitalistischen Industrienationen vorangetrieben, die unter Bedingungen verschärfter internationaler Standortkonkurrenz um die vorteilhaftesten Kapitalverwertungsbedingungen und profitträchtigsten Absatzmärkte kämpfen. Die Europäische Union ist neben den USA, Kanada und Japan als treibende Kraft an den Verhandlungen beteiligt. Begleitet werden die Verhandlungen von einem systematischen Lobbying pro Liberalisierung von Seiten der großen Dienstleistungskonzerne. Neben Banken und Versicherungen zählen große Wasserversorger, Energie-, Bildungs- und Gesundheitskonzerne (z. B. Vivendi, Suez, RWE) zu den Profiteuren des GATS.
Betrachtet man die Liberalisierungsforderungen der EU wird jedoch auch die Widersprüchlichkeit ihrer eigenen Politik deutlich. So fordert sie z.B. als einziges WTO-Mitglied die Liberalisierung der Wasserversorgung; darüber hinaus will sie außerhalb ihres Gebietes den ungehinderten Zugang zu Abfallmärkten, zum Energiebereich, zu Teilbereichen des Transports und zu Post- und Umweltschutzdiensten. Außerdem wurde gegenüber den USA nun doch verlangt, dass diese im Bereich der privat finanzierten höheren Bildungsdienstleistungen mit den GATS-Verpflichtungen der EU gleichziehen. Zunächst bedeuten die eigenen Forderungen nicht, dass im Gegenzug diese Bereiche in den eigenen Ländern gleichermaßen liberalisiert werden müssten. Ausnahmeklauseln zum Schutz der eigenen Märkte vor ausländischer Konkurrenz sind zeitweise möglich, wovon die EU bislang auch reichlich Gebrauch gemacht hat. So bleiben ihre jüngsten Liberalisierungsangebote auch noch deutlich hinter ihren Forderungen zurück. Anders als z. B. die EU können sich ökonomisch schwächere Staaten hingegen dem – nicht nur vom GATS sondern gleichzeitig auch von Institutionen wie IWF und Weltbank ausgehenden – Privatisierungsdruck kaum widersetzen.
Doch auch für die EU gilt: Wer hohe Forderungen an Drittstaaten stellt, weckt bei eben diesen ebenfalls Begehrlichkeiten bzw. kann auf Dauer wenig glaubwürdig für sich selbst Ausnahmen beanspruchen. So haben z.B. die USA im Gegenzug Interesse an der Deregulierung des Bildungs-, Gesundheits- oder Agrarsektors angemeldet. Spürbaren Druck empfängt die EU zur Zeit auch aus Japan, Australien oder Neuseeland, die einst für sich durchgesetzten Ausnahmeregeln nicht zu verlängern.
Selbst wenn auch in dieser Runde wichtige Bereiche der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge innerhalb der EU noch geschont werden sollten, bleibt ungewiss, wie lange dieser Schutz aufrechterhalten werden wird. Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten müssen laut GATS-Vertrag neue Verhandlungen aufgenommen werden, „um schrittweise einen höheren Stand der Liberalisierung zu erreichen“ (GATS, Artikel XIX).
Zudem zeigen die Erfahrungen vergangener Verhandlungsrunden, dass in den wichtigsten Streitfällen zwischen den Handelspartnern erst in letzter Minute Vereinbarungen erzielt worden waren, bei denen neben den prioritären Verhandlungsgegenständen sehr viele weitere Branchen und Bereiche mit einbezogen wurden. Gibt es einmal einen Kompromiss, ist der Druck sehr groß, nicht wegen einzelner Sektoren das Gesamtpaket wieder „aufzuschnüren“.
Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Letztlich werden Zugeständnisse gemacht werden müssen, will man den eigenen Marktzugang in Drittländern sichern.
Soziale Auswirkungen des GATS
Mit dem GATS würden so gesellschaftliche Risiken privatisiert, soziale Ungleichheit verschärft. Private sind nicht dem Gemeinwohl verpflichtet und können sich deshalb die Bereiche mit den besten Gewinnaussichten aussuchen. Fragen des gesellschaftlichen Bedarfs, der Sicherung des freien Zugangs für alle Menschen zu öffentlichen Gütern sind für sie nachrangig.
Die Erfahrungen mit bisherigen Liberalisierungen öffentlicher Dienste sind Qualitätseinbußen, Preissteigerungen, Arbeitsplatzabbau, Lohnsenkungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Abbau sozialer Infrastruktur. So stiegen beispielsweise in Paris mit der Privatisierung der Wasserversorgung die Wasserpreise von 1984 bis 1997 um 300 Prozent, in Ghana binnen eines Jahres gar um 200 Prozent. Seit der Privatisierung der Bahn sorgte Großbritannien mit schweren Bahnunfällen in Folge von abnehmenden Sicherheitskontrollen für Schlagzeilen. In den USA kam es zu Engpässen bei der Stromversorgung. Über 34 Millionen US-Amerikaner können sich in dem ausschließlich privat verfassten Gesundheitssystem keine Krankenversicherung leisten.
Nationale Arbeits-, Sozial- oder Umweltstandards werden so ausgehebelt, ohne das auf globaler Ebene gleichwertige Regelungen treten würden. Ob eine Leistung durch Kinderarbeit oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen erbracht wird, ist egal, wenn nur das Produkt betrachtet wird. Was droht, ist ein Unterbietungswettlauf durch unterschiedliche arbeits-, sozial-, umweltrechtliche Normen.
GATS-Verhandlungen: Geheimdiplomatie statt Demokratie
GATS-Verhandlungen: Geheimdiplomatie statt Demokratie Trotz der erheblichen Bedeutung der GATS-Verhandlungen finden diese unter weitest gehendem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Selbst Bundestagsabgeordnete beklagen sich darüber, dass sie nur spärliche und irreführende Auskünfte seitens des Wirtschaftsministeriums erhalten. So wurden die GATS-Verhandlungsentwürfe der EU-Kommission zwar Wirtschaftsverbänden mit der Bitte um Kommentar zugestellt, nicht jedoch dem Parlament. Parlamentarische Beratungen oder gar Entscheidungen über den Inhalt der europäischen Liberalisierungsforderungen und -angebote haben in einem nur sehr begrenzten Rahmen stattgefunden. Gänzlich unberücksichtigt blieb eine politische Diskussion über eigene Forderungen gegenüber Drittländern bzw. die Rolle der EU im internationalen Kampf um Marktzugang.
Das alles ist umso brisanter, als einmal eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen praktisch kaum rückgängig gemacht werden können. Bei Verstoß gegen die Regeln des GATS nach Öffnung eines Bereichs hat ein Staat mit Sanktionen seitens der WTO zu rechnen. Wer Liberalisierungen in einem Bereich komplett rückgängig machen möchte, muss sich zu Kompensationen verpflichten, die jedes Land, das von der Einschränkung betroffen ist oder sein könnte, individuell festlegt. Eine Rücknahme ist also mit derart hohen politischen und materiellen Kosten verbunden, dass sie sich kaum ein Land leisten kann.
Kernproblem ist: Mit dem GATS soll ein weltweiter Markt ohne jegliche politische Steuerung geschaffen werden. Ein privater oder deregulierter Dienstleistungsbereich ist jeglicher demokratischer Kontrolle und Gestaltung unzugänglich. Aber: Nur wenn die Bereiche der Daseinsvorsorge öffentlich verfasst sind, sind sie entsprechend politisch beeinflussbar und potentiell demokratisierbar.
JungdemokratINNen/ Junge Linke Berlin fordern
- Keine Privatisierung öffentlicher Dienste – Stoppt GATS!
- Öffentliche Dienste unter demokratische Kontrolle!
- Radikale Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der Länder der „Dritten Welt“ statt rücksichtsloser Liberalisierung des Welthandels!
- Für arbeits- und sozialrechtliche Mindeststandards weltweit!
- Demokratisierung statt privater Profitmaximierung!
Beschluss der ersten Landeskonferenz 2003 der JD/JL Berlin
Wirtschaft und Soziales
Gegen die Agenda 2010: Die ganze Richtung passt uns nicht!
Unter dem Namen Agenda 2010 wird der euphemistisch als „Reformpolitik“ bezeichnete größte und konzertierteste Anschlag auf das Sozialsystem in der Bundesrepublik zusammengefasst.
Unter dem Druck von Massenarbeitslosigkeit und leeren öffentlicher Kassen werden die daraus resultierenden Lasten vor allem an Beschäftigte, Erwerbslose und andere Bezieher öffentlicher Leistungen weitergegeben. Unter dem Vorwand der Senkung der Lohnnebenkosten werden die Kosten einseitig den ArbeitnehmerInnen aufgebürdet.
Standortpolitik wird mit angeblichen Wettbewerbsnachteilen, die Deutschland in der weltweiten Konkurrenz hätte, gerechtfertigt. Dass Deutschland Exportweltmeister ist, dass die Unternehmen Rekordgewinne einfahren, dass sich der Anteil der Lohnsteuern am Gesamtsteueraufkommen, verglichen mit dem Anteil der Steuern auf Gewinne, seit Jahren konsequent erhöht hat, sind Argumente, die in den Debatten des gesellschaftlichen Mainstreams nahezu vollständig marginalisiert sind.
Stattdessen wird mit einer beeindruckenden Vehemenz auf den Gewerkschaften als der wichtigsten gesellschaftlichen Kraft, die das alles zumindest nicht aktiv mitträgt, herumgehackt, und das immer stärker, je schwächer ihre Position in den Auseinandersetzungen wird. In diesem gesellschaftlichen Klima finden die „Reformbestrebungen“ der rot-grün-schwarz-gelben Einheitsregierung statt.
Mit den „Hartz“-Reformen werden die Rechte von Erwerbslosen weiter beschnitten. Mit Leistungskürzungen, ausgeweiteten Zumutbarkeitsregelungen und verschärfter Gängelung werden die Lebensbedingungen für Erwerbslose weiter verschlechtert und Repressionssysteme ausgebaut, als wenn das Problem nicht der Mangel an vernünftig bezahlten Arbeitsstellen wäre, sondern die Unwilligkeit der Arbeitslosen, sich auf diese zu bewerben. Dadurch wird zugleich der Druck auf noch Beschäftigte verstärkt und der Niedriglohnsektor ausgeweitet.
Die weitere Privatisierung der Rentenversicherung kündigt die paritätische Finanzierung des Sozialversicherungssystems auf. Das Renteneintrittsalter soll erhöht werden. Damit wird nicht nur Lebensqualität für abhängig Beschäftigte weiter verschlechtert, sondern auch das Arbeitslosigkeitsproblem weiter verschärft.
Mit der Ausweitung der Scheinselbständigkeit („Ich-AG“) und der Aushöhlung des Kündigungsschutzes vor allem für ältere ArbeitnehmerInnen wird der Druck auf die Beschäftigten weiter verschärft.
Im Rahmen der Gesundheits„reform“ werden durch Leistungskürzungen, Praxisgebühr und erweiterte Zuzahlungspflicht wiederum Risiken privatisiert und das paritätische Finanzierungsmodell durch die Hintertür entsorgt.
Doch Bundesregierung, konservativ-liberale „Opposition“ und Unternehmervertreter haben noch lange nicht genug: Immer weitere neoliberale Reformen werden gefordert und angekündigt. Der nächste große Schritt wird die Steuerreform sein, die mit weiteren „Entlastungen“ für Besserverdienende die Finanzlöcher hervorrufen wird, mit denen dann die nächsten sozialen „Einschnitte“ gerechtfertigt werden.
Zu diesen „Reformen“ sagen wir: Reform ist, wenn’s den Menschen besser geht! JungdemokratINNen/Junge Linke stellen sich dieser Politik entschieden entgegen, denn:
Die ganze Richtung passt uns nicht!
Wir halten es für unverzichtbar, diesen Entwicklungen eine möglichst breite gesellschaftliche Protestbewegung entgegen zu stellen, die von der radikalen Linken bis zu Gewerkschaften und den verbliebenen Linken in SPD, PDS und Grünen reichen muss.
Mittelfristig können die Finanzierungsprobleme der sozialen Sicherungssysteme gelöst werden, wenn durch Lohnerhöhungen und Abbau der Arbeitslosigkeit die Kassen sich wieder auffüllen, außerdem muss der privat angeeignete gesellschaftliche Reichtum über Steuern endlich wieder zur Finanzierung der Aufgaben des Gemeinwesens herangezogen werden.
Auch wenn wir langfristig weitergehende Forderungen haben intervenieren wir in die aktuelle Debatte mit folgenden, gerade in die der aktuellen Regierungspolitik entgegengesetzte Richtung weisenden Forderungen
- Zurücknahme aller Leistungskürzungen, Gebührenerhöhungen und Sanktionsverschärfungen im Rahmen der Agenda 2010
- Rücknahme der Zumutungen für Erwerbslose – Ausbau, nicht Einschränkung der Rechte von Erwerbslosen
- Leiharbeit in sozial und rechtlich abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse umwandeln, Billigjobs abschaffen
- Erhalt der Tarifautonomie und der Flächentarifverträge
- radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
- Lohnerhöhungen, die den gestiegenen gesellschaftlichen Reichtum an die Beschäftigten weitergeben
- Rücknahme der Gesundheitsreform und Abschaffung der privaten Krankenkassen und Versicherungspflicht für alle in der gesetzlichen Krankenversicherung
- ein solidarisches Rentensystem, das Alterarmut verhindert und für alle ein Altwerden in Würde ermöglicht
- massive Besteuerung des gesellschaftlichen Reichtums, Wiedereinführung der Vermögenssteuer
- Einführung einer die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben sichernden sozialen Grundsicherung
Beschluss der ersten Landeskonferenz 2004 der JD/JL Berlin
Wirtschaft und Soziales
Gesundheitspolitik: Privatisierung macht krank!
Die Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme geht auch unter der rot-grünen Bundesregierung weiter. Dies hat die Rentenreform aus dem Sommer 2001 deutlich gemacht. Die Teilprivatisierung der Rentenversicherung steht exemplarisch für die zu beobachtende (re-)Privatisierung von Lebensrisiken bzw. den Abbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme. Ähnliches lässt sich seit einigen Jahren auch im Gesundheitsbereicht beobachten.
Auch hier gerät das solidarische Finanzierungsmodell der gesetzlichen Krankenversicherung immer mehr unter Druck. Mit dem Argument der „Kostenexplosion“ wird der Ausstieg aus dem solidarischen Gesundheitssystem als unausweichlich dargestellt. Die anstehende Gesundheitsreform soll deshalb vor allem für Kostensenkung sorgen. Wie das genau aussehen soll, ist im Augenblick noch Gegenstand heftigster Auseinandersetzungen zwischen Politik und VertreterInnen der verschiedenen Lobbygruppen im Gesundheitssystem. Trotz allem ist zu befürchten, dass die Privatisierung des Gesundheitssystems einen neuerlichen Schub erfahren wird, sofern es keinen starken gesellschaftlichen Widerstand dagegen gibt.
Soziale Sicherungssysteme sollen – gemäß ihres eigenen Anspruchs – allgemeine Lebensrisiken ebenso mindern wie soziale Folgewirkungen einer kapitalistischen Ökonomie, „selbstverständlich“ ohne diese grundsätzlich in Frage zu stellen. So war auch die staatliche Einführung eines Systems von Sozialversicherungen für Arbeitslose, Rentner und Kranke im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts nicht Ausdruck humanistischer Ideale, sondern vielmehr die Konzession gegenüber der erstarkenden Arbeiterbewegung, mit der deren Fundamentalkritik an der neuen kapitalistischen Wirtschaftsweise und am deutschen Kaiserreich der Wind aus den Segeln genommen werden sollte. Betrachtet man beispielhaft die Auswirkungen von Privatisierung und Liberalisierung im Gesundheitssystem, wäre es jedoch zynisch, aus einer berechtigten Kritik am zum Teil repressiven Charakter des Sozialstaats zu folgern, soziale Sicherungssysteme müssten nicht gegen ihren Abbau verteidigt werden. Eine Privatisierung des Gesundheitssystems trifft insbesondere Alte, chronisch Kranke und sozial schlechter gestellte Menschen sowie Menschen, deren Verhalten als abweichend von der Norm definiert wird. Traurige Tatsache auch in reichen Industrieländern ist: Je geringer die soziale Stellung (gemessen an Bildungsabschluss, Beruf und Einkommen), desto schlechter ist der Gesundheitszustand und desto geringer ist die Lebenserwartung. Diese Menschen haben daher im Durchschnitt einen wesentlich höheren Bedarf an Leistungen der Krankenversorgung. Gerade für sie ist deshalb eine am Prinzip der Solidarität orientierte Krankenversicherung besonders wichtig. Zudem wird so für alle Menschen das unkalkulierbare Risiko krank zu werden, zumindest hinsichtlich der dadurch anfallenden Behandlungskosten solidarisch umgelegt. Auf einem solchen Solidarmodell beruht die gesetzliche Krankenversicherung, denn hier hat jeder Versicherte – zumindest grundsätzlich – unabhängig von der Höhe seiner Beiträge und dem individuellen Gesundheitszustand einen Rechtsanspruch auf jene Leistungen, die zur Behandlung der Krankheit erforderlich sind.
Seit Mitte der 70er Jahre, als die GKV aufgrund des Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der mit ihr rückläufigen Einnahmen in eine Finanzierungskrise geriet, ist der Umfang des Leistungskatalogs vermehrt Angriffen ausgesetzt. Anfang der 90er Jahre leitete die konservativ-liberale Bundesregierung einen tiefgreifenden Wandel ein. Ständige Klagen über angeblich „zu hohe Lohnnebenkosten“ und „nicht mehr finanzierbare Ausgaben“ im Gesundheitswesen dienen seitdem der Legitimation von Markt- und Wettbewerbselementen im Krankenversicherungssystem. Die Akteure im Krankenversicherungssystem (Krankenkassen, Ärzte, im Prinzip auch die Versicherten selbst) sollen demnach zukünftig auch im Gesundheitssystem uneingeschränkt ihren ökonomischen Eigeninteressen folgen. Ein Denken, welches Gesundheitsversorgung einzig unter dem Aspekt der Kostenreduzierung betrachtet, führt dazu, dass eine optimale Gesundheitsversorgung, die sich am gesellschaftlichen Bedarf orientiert, eine immer geringere Rolle spielt.
Menschen werden zunehmend – wie bereits in den privaten Krankenkassen praktiziert – individuell für ihre Krankheiten verantwortlich gemacht, um damit eine höhere individuelle Kostenübernahme für Vorsorge und Behandlung zu verknüpfen. Für jeden spürbar ist diese zunehmende Privatisierung von Gesundheitskosten dadurch, dass schon seit einigen Jahren für viele Regelleistungen der GKV (Verschreibung von Arzneimitteln, Kur- und Krankenhausaufenthalten, Zahnersatz etc.) Zuzahlungen in Kauf genommen werden müssen. Darüber hinaus wurde damit begonnen, vormals als medizinisch notwendig definierte Leistungen aus dem Katalog der GKV zu streichen. Dies reicht von „Bagatellerkrankungen“ wie Erkältungen oder leichten Verletzungen über Schwangerschaftstests bis hin zu verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Mammographien), Kuren und Physiotherapien. PatientInnen bleibt hier häufig nur die Möglichkeit, Medikamente oder Behandlungen aus eigener Tasche zu zahlen oder sich zusätzlich privat zu versichern.
Insgesamt kann man feststellen, dass die als „Kostendämpfungsmaßnahmen“ bezeichneten Leistungseinschnitte in der Regel nicht die Gesamtkosten senken, sondern nur die von der Kasse zu tragenden Kostenanteile. Damit aber findet eine Kostenverschiebung zu Lasten der Kranken statt, das Solidarprinzip wird also schon jetzt durch die Hintertür beschnitten. Geht diese Entwicklung weiter, so ist zu erwarten, dass sich künftig ärmere Menschen eine für sie notwendige Behandlung nicht mehr listen können. Privatisierung gefährdet so nicht nur die Qualität der medizinischen Versorgung, sondern wirkt auch sozial selektiv zu Lasten ärmerer Menschen.
Um eine an den Bedürfnissen der Menschen orientieret Gesundheitsversorgung zu garantieren und die sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen abzubauen, muss das solidarische Gesundheitssystem beibehalten und ausgebaut werden. JungdemokratINNen/Junge Linke Berlin kämpfen daher gegen eine zwei- oder Mehrklassenmedizin, in der nur eine stark reduzierte Grundversorgung für die Mitglieder der gesetzlichen Kassen gewährleistet wird. Optimale Gesundheitsversorgung ist ein öffentliches Gut, auf das jeder Mensch ein Recht haben muss und das deshalb nicht von Einkommen des Einzelnen abhängig sein darf. Allen Menschen muss unabhängig von ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand und der Höhe ihres Versicherungssatzes in gleicher Weise geholfen werden. Der Staat muss für dieses Gesundheitssystem die Gesamtverantwortung tragen. Da de finanzielle Krise der GKV vor allem aus gesunkenen Einnahmen aufgrund von niedrigen Lohnabschlüssen und der stark gestiegenen Arbeitslosigkeit resultiert, würden schon der Abbau der Massenarbeitslosigkeit und höhere Tarifabschlüsse eine finanzielle Entlastung bedeuten und darüber hinaus zu einer Senkung der Krankenversicherungsbeiträge führen. Notwendig ist aber zudem die sofortige Aufhebung der Privilegien „Versicherungspflichtfreiheit“ und „Beitragsbemessungsgrenze“ für die Bezieher höherer Einkommen. Denn die Beitragsbemessungsgrenze sorgt dafür, dass Einkommen oberhalb dieser Grenze nicht bei der Berechnung des Beitragssatzes berücksichtigt wird, also sozialversicherungsfrei bleibt. Die zur Zeit gleich hohe Versicherungspflichtgrenze hingegen ermöglicht es ArbeitnehmerInnen mit einem Einkommen von mehr als 3.375 Euro nicht mehr zwangsweise Mitglied in der GKV sein zu müssen. Vor allem gesunde, alleinstehende und junge Beschäftigte mit höheren Einkommen können so gezielt von den privaten Krankenversicherungen abgeworben werden. Menschen mit sogenannten „schlechten Risiken“ (z.B. Alte, chronisch Kranke) sowie Versicherte mit niedrigen und mittleren Einkommen verbleiben hingegen in der GKV. Es liegt auf der Hand, dass diese Praxis für die GKV zwangsläufig niedrigere Einnahmen, höhere Kosten und damit wiederum höhere Beitragssätze verursacht. Auch die von rot-grün angestrebte Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze auf 3.825 Euro monatlich wird bei Weitem nicht ausreichen, um die Probleme der GKV zu beheben.
Ziel einer solidarischen Gesundheitspolitik muss die Einführung einer einzigen, allgemeinen Krankenkasse unter öffentlicher Kontrolle sein: langfristiges Ziel ist ein freier Zugang zu Gesundheitsversorgung als Teil einer steuerfinanzierten Sozialen Grundsicherung. Statt marktliberaler Steuerungsinstrumente sind zudem Instrumente notwendig, die den Profitinteressen privater LeistungsanbieterInnen im Gesundheitssystem entgegenwirken. Positivlisten mit von unabhängiger Seite geprüften Medikamenten oder die Verschreibung von Wirkstoffen wären hier ein richtiger Schritt hin zu einer stärkeren Regulierung des Pharmamarktes. So könnten die Kosten des Gesundheitssystems statt durch die Einschränkung der Gesundheitsversorgung durch Abschöpfung der enormen Profite von Pharmakonzernen und anderer privater Profiteure im Geschäft mit Krankheit bzw. Gesundheit sinnvoll reduziert werden.
JungdemokratINNen/Junge Linke Berlin fordern
- Für den Erhalt und Ausbau eines solidarischen Gesundheitssystems!
- Keine Profite mit Krankheiten!
- Keine Verknüpfung von spezifischen Verhaltensweisen und körperlichen Dispositionen mit der Gewähr von medizinischen Leistungen!
- Keine Definition und Erfassung von „Risikogruppen“!
- Regulierung des Pharmamarktes statt Liberalisierung des Gesundheitssystems!
- Individuelle Kostenfreiheit für alle!
- Umfassende soziale Grundsicherung für alle!
- Für Selbstbestimmung der PatientInnen!
Beschluss der 2. außerordentlichen Landeskonferenz der JungdemokratINNen/Junge Linke Berlin vom 10.11.2002